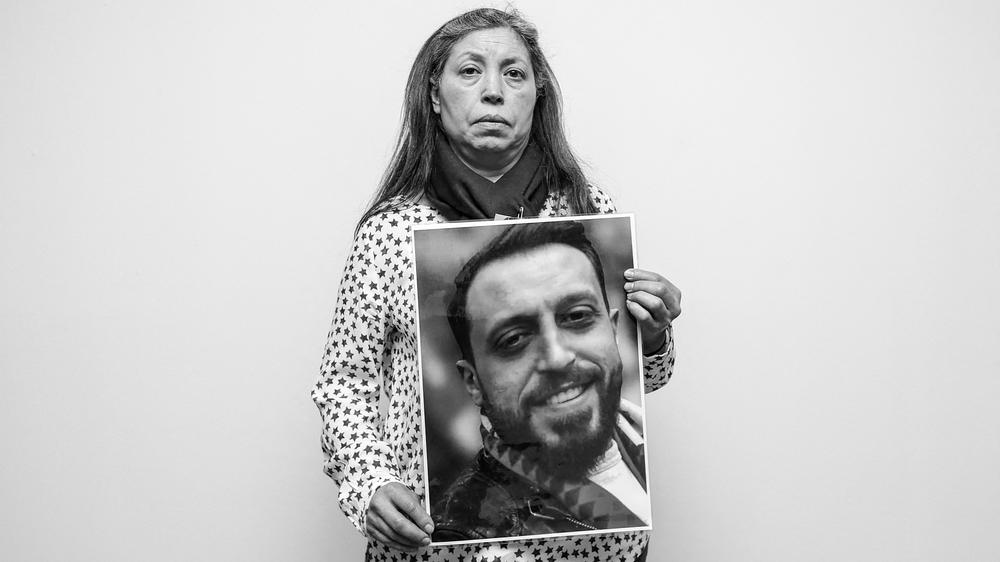Sollten wir an die Shoah nur erinnern,
wenn Jüdinnen versöhnlich sind? An Rassismus nur, wenn die Opfer von
Rassismus ihre Kritik freundlich formulieren? An Femizide, wenn die betroffenen
Frauen sich gut benehmen? Nach dem fünften Jahrestag des Anschlags in
Hanau ist eine Diskussion entbrannt, wie an Gewalt erinnert werden sollte und
wer das eigentlich entscheiden darf. Das ist nicht zuletzt nach dem hinter uns
liegenden Wahlkampf eine wichtige Diskussion, weil auch hier der rhetorische
Bezug auf das „Nie Wieder“ der deutschen Erinnerungskultur zentral war und die
Frage, ob dieses „Nie Wieder“ für alle gilt, und was es eigentlich politisch bedeutet.
Aber was ist passiert? Am 19. Februar
hielt die Mutter von Sedat Gürbüz – eines der Opfer des Anschlags – eine Rede
und erhob schwere Vorwürfe gegen die Stadt. Ihrer Meinung nach trage diese eine
wesentliche Verantwortung für den Anschlag, sei ihrer Verantwortung der
Aufarbeitung nicht ausreichend nachgekommen und bereichere sich an öffentlichen
Geldern. Zwei Tage nach der Gedenkfeier veröffentlichte die Koalition von CDU,
SPD und FDP des dortigen Stadtparlaments eine Pressemitteilung, in der sie sich
gegen diese „schockierenden Worte“ verwahrte und als Konsequenz ein Ende der
Gedenkveranstaltungen in ihrer bisherigen Form ankündigte. Verschärft wurde
diese Mitteilung dadurch, dass die Verfasser der Mutter eine negative
Einstellung zu Deutschland unterstellten und private Informationen preisgaben, als
sie fragten, warum sie „bei einer derartigen Gefühlslage die deutsche
Staatsbürgerschaft beantrage“.
Auch bei den Hanauer Gedenkfeiern der
vergangenen Jahre war es um die Verantwortung des Staates für das Attentat gegangen
und die Frage, warum eine Aufarbeitung des polizeilichen und behördlichen
Versagens so lange dauerte und bis heute nicht vollständig aufgeklärt ist.
Ein
paar Aspekte dieses staatlichen Versagens zur Erinnerung: In der Nacht vom 19.
auf den 20. Februar 2020 hatte der Polizeinotruf nicht funktioniert. Die Tür
des Notausgangs an einem der Tatorte war aufgrund einer polizeilichen Anordnung
verschlossen. Die Todesnachrichten wurden den Familien in der Nacht des
Anschlags auf herabwürdigende Art und Weise überbracht, manche Angehörigen
zunächst gar nicht informiert. In der Zeit nach dem Anschlag wurden die Opfer
verdächtigt, Rache nehmen zu wollen, während der Vater des Täters immer wieder
Drohungen aussprach, ohne dafür konsequent belangt zu werden. Und die Politik
sagte den Angehörigen erst Unterstützung zu, feilschte dann aber um den Ort des
Gedenkens.
Was sind die verlorenen Kinder Hanaus
wert? Es ist eine Frage, die der Politik, der Polizei, dem hessischen Parlament
und den Bundesregierungen seit dem Attentat immer wieder gestellt wird. Indem
sie diese Frage in den Mittelpunkt der Erinnerung rücken, haben die Angehörigen
im Netzwerk mit anderen Betroffenen rassistischer und antisemitischer Anschläge
auch eine neue Art des Gedenkens entwickelt – weil sie neben einer Aufklärung
der Taten auch echte Konsequenzen fordern.
„Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst“
ist ein Satz von Ferhat Unvar, eines der Opfer von Hanau. Er versinnbildlicht,
wie die Entschlossenheit der Angehörigen, gegen das Vergessen zu kämpfen, zu
einer Bewegung anwuchs, die in diesem Land von vielen marginalisierten Menschen
getragen wird. Unterschiedliche Erinnerungskämpfe wurden auf diese Weise Teil einer
vielfältigen zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung, die heute Teil der
deutschen Erinnerungsarbeit ist, sie bereichert und aktualisiert.
Man könnte meinen,
dass genau das eine lebendige Erinnerungskultur ausmacht: dass sie von der
Zivilgesellschaft getragen wird. Die Angehörigen erschaffen Räume, in denen sie
sich gemeinsam erinnern. An diesen partizipiert die Gesellschaft, indem sie die
Geschichten der Opfer aufgreift. Eine wichtige Pointe dieser Arbeit besteht dabei
in der Mahnung, die politischen und gesellschaftlichen Umstände nicht zu
vergessen, die solche Morde erst möglich gemacht haben.
Eine Erinnerungsarbeit
in diesem Sinne darf also wehtun und wütend sein. Sie muss an politische
Fehler erinnern und Aufklärung einfordern. Und insbesondere, wenn das nicht
geschieht, darf sie auch vorwurfsvoll sein. Und das gilt ausdrücklich auch für
Trauerreden von Betroffenen.
So hätten die Reden am 19. Februar die
verantwortlichen Politikerinnen auch in diesem Jahr berühren und zu Selbstreflexion anregen können. Aber die politischen Vertreterinnen von SPD,
CDU und FDP in Hanau entschieden sich für eine Abwehr der Kritik. Der Titel
ihrer Pressemitteilung lautete entsprechend: „Wer Achtung und Respekt
einfordert, muss auch mit Achtung und Respekt agieren.“ Was hier vordergründig
als eine Frage des richtigen Benehmens gerahmt wird, muss als Versuch
verstanden werden, sich der offenbar zunehmend lästigen Frage nach politischer Verantwortung
zu entledigen. Als wären die Verfasser der Pressemitteilung es langsam leid,
sich weiterhin mit dem Erinnern zu beschäftigen.