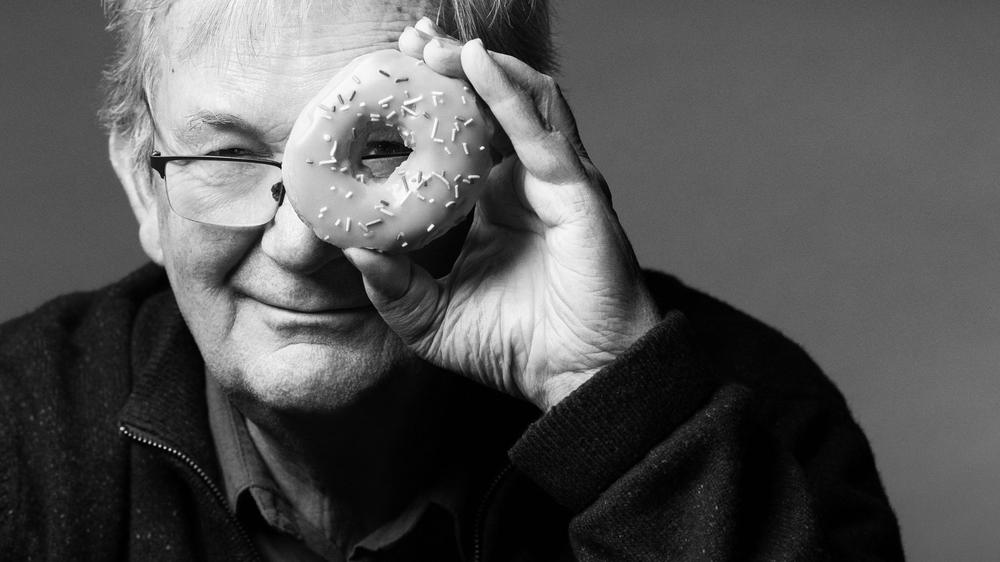Am Eingang des Bunkers wird man von zwei russischen Polizisten begrüßt, pinkes Licht weist den Weg nach vorne. Dort warten 15 Räume auf Besucher. Räume, zu denen die Polizisten wohl den Eintritt verbieten würden – wenn sie keine lebensgroßen Aufkleber wären.
heißt die Ausstellung im Münchner Haus der Kunst, die vom 6. September bis zum 2. Februar im ehemaligen Luftschutzkeller des Museums gezeigt wird. Kuratiert hat sie Marija Aljochina, eines der Kernmitglieder der Gruppe. Es geht um die Geschichte des Kollektivs, angefangen bei der Gründung 2011 bis zur Flucht aus Russland kurz nach Kriegsausbruch. Und es geht um die Geschichte des Landes selbst: „Wenn man durch die Ausstellung geht, kann man nachvollziehen, welchen Weg Russland in den vergangenen zwölf Jahren eingeschlagen hat“, sagt Aljochina.
Eine Woche vor der Eröffnung führt Aljochina durch die noch nicht ganz fertigen Räume. Es fehlen die Videoinstallationen, die die Verhaftungen der Mitglieder zeigen werden, ihre Musikauftritte und Demonstrationen. Die Wände sind neongelb, pink und giftgrün gestrichen und erinnern an die bunten Sturmhauben und Kleider, die die Aktivistinnen bei ihren Aktionen tragen. Aljochina ist mit ihrem schwarzen Kleid und den schwarzen Flipflops ein dunkler Punkt in dieser grellen Landschaft. Sie bewegt sich schnell von Zimmer zu Zimmer, ihre Schritte hallen im Flur nach.
In einem der ersten Räume sieht man Fotos von einem der ersten großen öffentlichen Auftritte der Gruppe – ein Konzert am Roten Platz in Moskau Anfang 2012. Alle acht Teilnehmer wurden festgenommen, verprügelt und zu kurzen Gefängnisstrafen verurteilt. „Unsere ersten Aktionen zogen kaum Konsequenzen nach sich, damals gab es noch regelmäßig Demos mit zahlreichen Teilnehmern“, erzählt Aljochina. Mit den Jahren hätten die Repressionen massiv zugenommen. Selbst ihre Haft von knapp eineinhalb Jahren nach dem berühmten „Punk-Gebet“ in einer Moskauer Kathedrale im selben Jahr findet sie im Vergleich zu heutigen Strafen harmlos. „Damals klagte ich gegen die Straflager, damit man unsere Arbeitszeit kürzte, den Lohn erhöhte und unsere Kaserne renovierte – mit Erfolg. So etwas ist heute nicht mehr möglich.“ Der Raum über die Zeit im Straflager ist einer der wenigen, die vollständig weiß sind. Tagebuchartige Einträge wurden mit schwarzem Edding auf die Wand gekritzelt, die Fotos zeigen karge Zimmer und das schneebedeckte Lager.
Aljochina bleibt an einer Wand im Flur stehen, auf der man ein Plakat mit vielen Gesichtern sieht: Alexej Nawalny, Boris Nemzow und Pussy Riot. Oppositionelle, die nach Russlands Krim-Annexion 2014 aufgrund ihrer kritischen Aussagen als „ausländische Agenten“ denunziert worden sind. „Mit der Annexion begann eine Zeit, in der wieder die Sprache des Kalten Krieges benutzt wurde. Man bezeichnete uns als Feinde der Nation.“
Je weiter man sich thematisch der Gegenwart nähert, desto mehr nimmt die innere Angespanntheit zu. Man weiß, wie es weiterging. Das Verfassungsreferendum Anfang 2020, welches Wladimir Putins Macht für die nächsten Jahre absicherte. Mitglieder von Pussy Riot, die bei Demos gegen das Referendum brutal zusammengeschlagen wurden. Restriktive Internetgesetze, die faktisch jeden Like und Post, der gegen Putins Politik geht, zu einem Strafbestand machen. Marija Aljochina und ihre Mitstreiterin Lucy Shtein, die aus diesem Grund von Mai 2021 bis März 2022 fast jeden Monat für einige Tage wiederholt in Haft kamen.