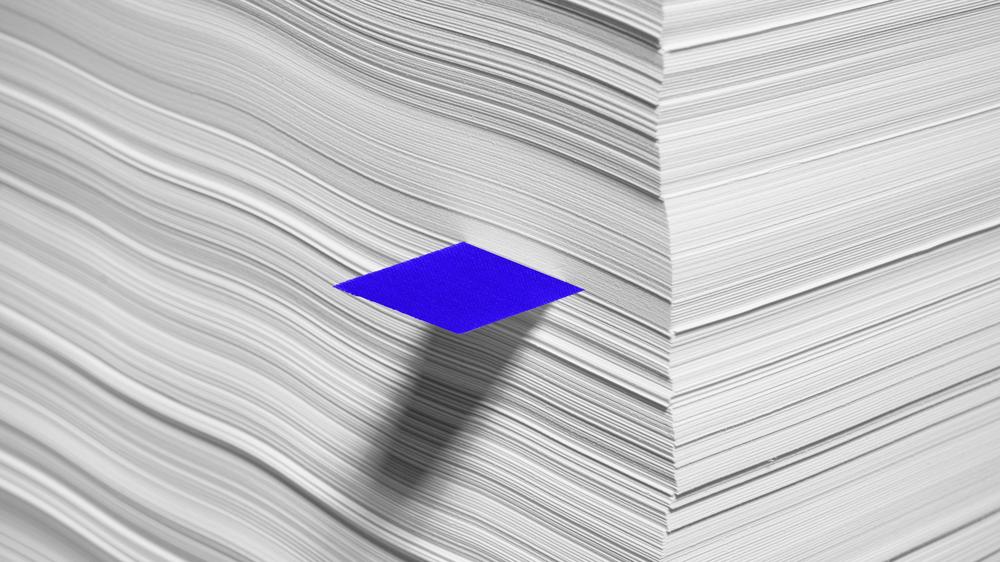Das
Leiden an der Bürokratie wird spätestens dann spürbar, wenn die Frist für die
jährliche Steuererklärung näher rückt. Sie lähmt das laufende Geschäft,
produziert dysfunktionale Nebenfolgen, nur wenige verstehen vollends ihre
Regeln und Regelungen – und sie kostet vielen viele Nerven. In Deutschland
galten Anfang des Jahres 2014 1.671 Gesetze mit insgesamt 44.216 sogenannten Einzelnormen.
Zehn Jahre später waren es über 100 Gesetze (1.792) und fast 8.000 Einzelnormen
(52.155) mehr, dies war die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage
der AfD.
Kein
Wunder also, dass der Bürokratieabbau zu den Zielen jeder Staatsreform gehört.
Einen handlungsfähigen Staat mit weniger Bürokratie hat auch die aktuelle
Initiative der ehemaligen Bundesminister Thomas de Maizière und Peer Steinbrück,
der Medienmanagerin Julia Jäkel und dem ehemaligen Verfassungsrichter Andreas
Voßkuhle als Ziel. Der Soziologe Stefan Kühl hat die Kritik an der Bürokratie jüngst
einer Kritik
unterzogen und davor gewarnt, dass zu viel Bürokratiekritik im Staatsverdruss
enden würde. Er geht nicht darauf ein, aber man kann ahnen, worin er die
Gefahren einer exzessiv betriebenen Bürokratiekritik sieht: im Kettensägenmassaker
von Elon Musks Doge-Einheit der neuen US-Regierung. Allerdings stellen sich
Bürokratiekritik und Bürokratiekritik-Kritik bislang häufig nicht die Frage, warum
wir uns überhaupt mit einem hypertrophen, also übermäßig wachsenden Staat
herumschlagen.
Es
war gerade die Pointe des modernen Staates, nicht kapitalistische
Interventionselemente zu produzieren, die Probleme wie Konjunkturkrisen,
Arbeitslosigkeit, Armut und Arbeitskräftemangel beheben sollten. Denn die Unternehmen
verhalten sich in der Regel nicht im Interesse des Gesamtsystems. Der Staat
produziert die Infrastruktur für das Alltagsleben, er nimmt sich der Probleme
und Widersprüche an, die eine auf sich allein gestellte Wirtschaft immer
hinterlassen würde, in der Umweltpolitik, der Ungleichheit oder der Ausbildung.
Der expansive Kapitalismus hat den Planeten und die natürlichen Ressourcen
stark vernutzt, sodass der Staat eingreift, um die Grundlagen seiner
Reproduktion zu sichern.
Dies
ist ein Grund, aber noch lange nicht der einzige, warum der Staat zur Hypertrophie
neigt. Denn der umfassende Interventionsstaat erzeugt immer wieder Konflikte,
da seine Ausdehnung die Profitabilität von Unternehmen behindern kann. Nicht
nur darum stellen sich immer wieder Fragen der Legitimation und der Loyalität
des Staates. Schon Anfang der 1970er Jahre wiesen Claus Offe und Jürgen
Habermas darauf hin, dass der Staat gerade in seinen Versuchen, die
Gesellschaft zu modernisieren und rationaler zu gestalten, beständig
unerwünschte Nebenfolgen erzeugt, die an den Bedürfnissen von Bürgern und
Unternehmen vorbeigehen.
Auch im Neoliberalismus wächst der Staat
Der
Staat ist nicht nur ein immer komplexeres Instrumentarium geworden, sondern
auch ein immer größeres und geradezu allgegenwärtiges. Die Staatsquote, also
der Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt, lag im Jahr 1969 in den
USA und Deutschland noch etwa gleichauf bei knapp unter 30 Prozent. In den USA
war die Staatsquote im Jahr 2024 auf etwa 37 Prozent, in Deutschland auf
sagenhafte 49,5 Prozent gestiegen. Es täuscht, wenn man den Anstieg der USA für
moderat hält, da die US-Wirtschaft seit den 1980er deutlich stärker als die
deutsche gewachsen ist. Auch die Sozialleistungsquote ist in beiden Ländern
gestiegen, in den USA sogar noch stärker als in Deutschland.
Das
Phänomen ist nicht unbekannt. Bereits 1892 stellte der Ökonom Adolph Wagner das
„Gesetz der wachsenden Staatsausgaben“ auf, weil der Staat immer weitere
Leistungen erbringen müsse. Und auch
der 2020 verstorbene Anthropologe David Graeber sah im „ehernen Gesetz des
Liberalismus“ eine Naturwüchsigkeit am Werk: Reformen, die im Sinne der Märkte
die Bürokratie abbauen wollten, führen zu mehr Regulierungen, Vorschriften und
schließlich mehr Bürokratie.
Widerspricht
das nicht dem Common Sense? Ist nicht immer die Rede vom Neoliberalismus und
der Austerität, die die sozialen Verpflichtungen des Staates und die sozialen
Rechte zurückdrehen wollen? Tatsächlich ist beides richtig. Der Neoliberalismus
will den Staat – insbesondere den Sozialstaat – zurückbauen, dennoch wächst der
Staat weiter. Statt eines reduzierten entstand ein hypertropher Staat. Auch dem Neoliberalismus gelang es nicht, den Staat zurückzubauen. Wie kann das sein?
Die Antwort lautet: Es liegt an ihm
selbst. Denn
Deregulierung, Privatisierungen oder Public-Private-Partnerships haben häufig
zur Folge, dass nicht weniger, sondern mehr Kontrollen, Zertifizierungen,
Rankings, Evaluationen und Berichtsanforderungen, mehr bürokratische
Verrechtlichungen entstehen. Gerade der Ansatz des sogenannten progressiven
Neoliberalismus, einen gleichberechtigten Zutritt zum Markt zu ermöglichen,
erzwingt wiederholt ein regelsetzendes Eingreifen. Die Gesetze werden immer länger. Man versucht mit
ihnen die zunehmende Komplexität abzubilden, sich aber auch gegen
Rechtsstreitigkeiten abzusichern.