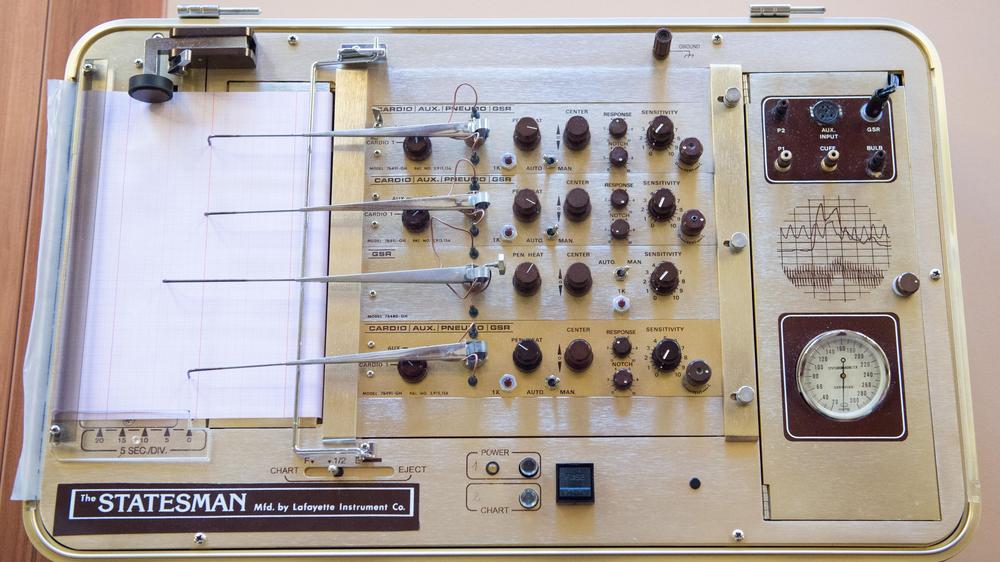Dass die Schutzmacht Amerika zum zweiten Mal von Donald Trump angeführt wird, der Deutschland als Gegner sieht, ist ein historischer Einschnitt. Der neu-alte Präsident hegte schon in seiner ersten Amtszeit einen besonderen Groll gegen das Land, aus dem einst sein Großvater Friedrich Trump in die USA eingewandert war. Die Europäer, allen voran die Deutschen, sieht Trump als gewiefte Schmarotzer, die sich von den USA beschützen lassen und zugleich die amerikanische Industrie mit ihren Exporten zerstören.
Donald Trumps erneute Amtsübernahme markiert das Ende einer Epoche des Transatlantizismus in der deutschen Außenpolitik – jenes Zeitalters, in dem Regierungen jedweder Couleur selbstverständlich davon ausgingen, dass das Bündnis mit Amerika die Sicherheit und den Wohlstand Deutschlands sichert. Nun geht die Angst um, das Gegenteil könnte der Fall sein.
Das ist ein politscher Einschnitt mit Wirkung auf die nationale Psyche, weit über außenpolitische Fachkreise hinaus. In der frühen Bundesrepublik war Transatlantizismus die Standardeinstellung aller führenden Außenpolitiker – ein Effekt der überragenden Bedeutung Amerikas für die Rückkehr des besiegten und diskreditierten Landes in die Weltgemeinschaft.
Es ist unklar, was an die Stelle der transatlantischen Ausrichtung treten könnte – der Einsatz für mehr europäische Eigenständigkeit, ein neuer Nationalismus, ein Arrangement mit den eurasischen Mächten Russland und China? All das würde mehr Unsicherheit bedeuten.
Joe Bidens Engagement für Europa war die Abweichung
Erst einmal ist die transatlantische Entfremdung zu verarbeiten. Bei Trumps erstem Wahlsieg 2016 konnte man die Orientierung auf „“ noch für eine Episode halten. 2020 schien sich diese Hoffnung mit Joe Bidens Eroberung des Weißen Hauses zunächst zu bestätigen. Amerika sei „zurück“, versprach der lebenslange Transatlantiker Biden in seiner Antrittsrede. Seine Parole nährte in Deutschland die Erwartung, die Vereinigten Staaten würden ihre Rolle als Garant der westlich geprägten Weltordnung, als Führungsmacht der Nato, als Beschützer Europas weiter ausüben.
Die US-Regierung übernahm nach der russischen Vollinvasion denn auch klaglos die Koordination der Ukraine-Hilfe und stellte große Summen bereit. Wie schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dem Kalten Krieg und den Balkankriegen führte Amerika auch im Ukraine-Krieg wieder – politisch, finanziell und militärisch. Die Rückkehr Donald Trumps spricht dafür, dass Joe Bidens Engagement für Europa die Abweichung war, und dass die politische Kontinentaldrift zwischen den USA und Europa weitergeht.
Sie hat nicht mit Trump begonnen, und sie wird nicht mit ihm enden. Transatlantiker haben schon lange keinen leichten Stand mehr, nicht erst seit den ersten Trump-Jahren, sondern mindestens seit der Amtszeit von George W. Bush.