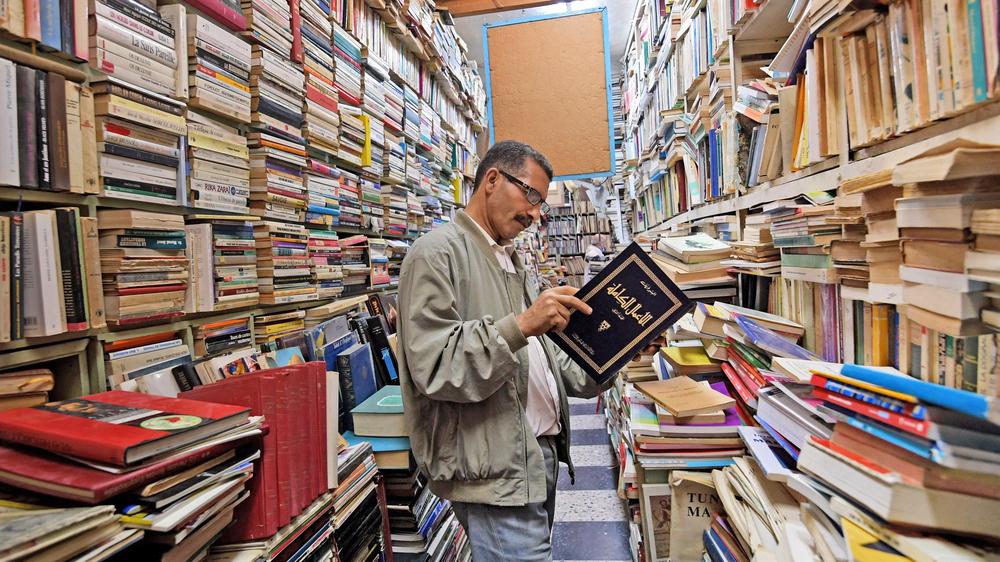DIE ZEIT: Frau
Hetzl, die europäische Kultur baut auch auf Übersetzungen aus dem Arabischen
auf. Die griechische Antike gelangte über die Bewahrung und Weiterentwicklung
in arabischen Texten wieder nach Europa. Das scheint in Deutschland kaum
bekannt. Warum?
Sandra Hetzl: Es gibt so gut wie kein Bewusstsein für die
vielen kulturellen und literarischen Kontinuitäten zwischen den Ufern des
Mittelmeers. Die gängige Erzählung ist so absurd wie einfach: Wir, Europa, der
Westen, sind die Erben der griechischen Antike. Die, die nur ein paar Kilometer
weiter südlich und östlich leben, sind das gänzlich Andere, gefühlt ferner als
Japan. Diese Grenzziehung ergibt für mich keinen Sinn, weder historisch noch
kulturell. Ich glaube, dass der Mangel an Bewusstsein für diese Querverbindungen
große Auswirkungen auf den Status der arabischen Literatur hat.
ZEIT: Was ist
deren Status heute in Deutschland?
Hetzl: Ein sehr geringer, gemessen an der geografischen Nähe
und politischen Bedeutung des Gebiets und seiner historischen Verflechtungen
mit Europa. Ich habe eine umfassende Studie dazu verfasst (PDF), für die ich mir ein
Jahrzehnt literarischer Übersetzungen aus dem Arabischen angeguckt habe, von
2010 bis 2020. In der vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels jährlich
herausgegebenen Liste mit den top 20 der Herkunftssprachen von ins Deutsche
übersetzter Belletristik kann man sehen, dass Literaturübersetzungen aus dem
Arabischen im Schnitt 0,3 Prozent aller übersetzten Neuerscheinungen ausmachen.
Sie liegen damit meist hinter Übersetzungen aus dem Altgriechischen und
Lateinischen. Dabei ist Arabisch eine der sechs Sprachen der Vereinten Nationen, und 2,8 Millionen Menschen in Deutschland haben einen arabischsprachigen
Hintergrund.
ZEIT: Warum
sollten sich mehr Menschen in Deutschland für arabische Literatur
interessieren?
Hetzl:
Zeitgenössische arabische Literatur schöpft aus uralten Traditionen und ist
gleichzeitig stark von europäischer und lateinamerikanischer Literatur
informiert. Möglicherweise wäre sie ein fehlendes Bindeglied, um uns selbst und
die Welt besser zu verstehen. Die Hauptprotagonisten in Wim Wenders Film sind zwei Engel, die die Gedanken aller Menschen hören
können. Dem kommt die Leseerfahrung übersetzter Literatur ein wenig gleich. Wie
wichtig wäre das erst, wenn es um die Gedanken von Menschen geht, die oft als
Feinde markiert sind? Dieses Zuhören und Lesen hat eine politische Dimension
und liefert Innenansichten, die die Dichotomie zwischen Eigenem und
vermeintlich Fremdem auflösen.
ZEIT: 1988 erhielt der ägyptische Schriftsteller Nagib Mahfuz den Literaturnobelpreis zugesprochen, was einen Moment lang weltweit die Aufmerksamkeit auf arabische
Literatur lenkte. Was ist davon geblieben?
Hetzl: Der
Literaturnobelpreis an Mahfuz und die Frankfurter Buchmesse im Jahr 2004, als
die arabische Welt Ehrengast war, – das waren die einzigen Male, dass literaturbetriebliche Faktoren für einen Anstieg an
Übersetzungen aus dem Arabischen gesorgt haben. Sonst sind es eher
außerliterarische Faktoren, oft negative, zum Beispiel die Terroranschläge vom
11. September 2001. Die Logik „Kenne deinen Feind“ führte zu vielen neuen
Übersetzungen, man wollte über Extremisten lesen. Später kam, etwas positiver
konnotiert, der Arabische Frühling und schließlich das Jahr 2015 mit der Flucht
vieler Menschen aus Syrien. Ein Bewusstsein für einen Kanon arabischsprachiger
Literatur gibt es in Deutschland nicht. Arabische Autoren werden hier eher
zufällig bekannt, zum Beispiel, weil sie eben hier gelandet sind, relativ
ungeachtet der Qualität ihres Schreibens, besonders, wenn sie damit Debatten
beliefern, die in Deutschland geführt werden, etwa über Islamismus oder
Integration.