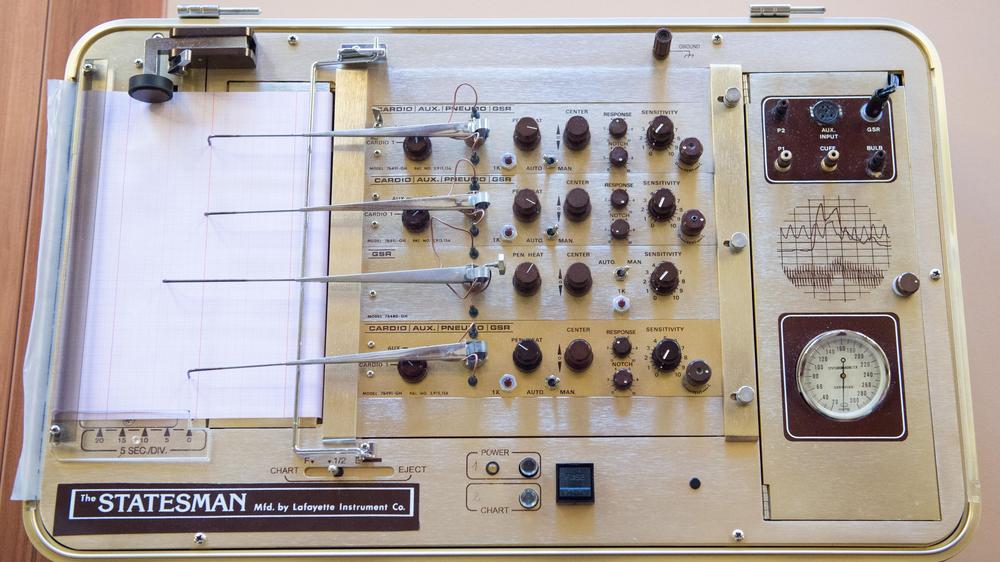Im Jahr
1919, auf dem Höhepunkt einer globalen Krise, die aus den Wirren der Russischen
Revolution, den Verwüstungen des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch der
großen europäischen Reiche resultierte, verfasste der irische Schriftsteller
William Butler Yeats seinen berühmten Abgesang auf die Alte Welt: „Dinge fallen
auseinander, das Zentrum kann nicht halten. / Bloße Anarchie ist über die Welt
hereingebrochen.“
Seine Worte
wurden kürzlich vom ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden in einer Rede vor der
Generalversammlung der Vereinten Nationen in Erinnerung gerufen. Damals wie
heute stehe die Welt an einem kritischen historischen Scheidepunkt, warnte er: „Ich
glaube wirklich, dass wir an einem neuen Wendepunkt der Weltgeschichte stehen,
an dem die Entscheidungen, die wir heute treffen, unsere Zukunft für die
kommenden Jahrzehnte bestimmen werden.“ Der Präsident nutzte die Gelegenheit
für einige historische Überlegungen. Er erinnerte an die globale Krise der
frühen 1970er-Jahre, als er zum ersten Mal zum Senator gewählt wurde auf dem
Höhepunkt des Kalten Krieges, als Kriege von Nahost bis Vietnam tobten und sein
eigenes Land in einer innenpolitischen Krise gespalten war: „Damals befanden
wir uns an einem Wendepunkt, einem Moment der Spannung und Unsicherheit.“ Im
Laufe des 20. Jahrhunderts, so führte er fort, habe die Menschheit
große Krisen gemeistert. Heute, angesichts der eskalierenden Kriege von
Osteuropa bis zum Nahen Osten und der tieferen Spaltungen unserer
Gesellschaften, sei es wieder Zeit für vereintes Handeln.
Es war
nicht das erste Mal, dass der damalige US-Präsident unsere Zeit als einen „Wendepunkt“
in der Weltgeschichte bezeichnete. Tatsächlich prägten Warnungen vor einem
„Wendepunkt“ seine gesamte Präsidentschaft. „Ich habe schon oft
gesagt, dass wir uns an einem Wendepunkt befinden“, erklärte er auch in seiner letzten Rede zur Außenpolitik im vergangenen
Monat. „Die Ära, die dem Kalten Krieg folgte, ist vorbei. Eine neue Ära hat
begonnen.“
Viele
stimmen dieser Einschätzung zu. Das Konzept des „Wendepunkts“ hat in der
Politik weltweit großes Echo gefunden. Überall ist es von Politikern – darunter
zuletzt auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – aufgegriffen
worden, um vor der aktuellen weltpolitischen Lage zu warnen. In der Tat ist die heutige Welt
geprägt von der Stabilisierung autokratischer Staaten und dem Auftrieb antidemokratischer
Kräfte, der territorialen Konflikte in der Ukraine, Israel und Taiwan, der
Klimakrise und einer neuen, unvorhersehbaren, durch künstliche Intelligenz
angetriebenen industriellen Revolution. Der Historiker Adam Tooze hat diesen Zusammenklang als
„Polykrise“ beschrieben.
Dieses
Phänomen ist freilich nicht neu. Im Laufe der Geschichte wurde die Welt immer
wieder von großen Krisen erschüttert – politischen Unruhen, Kriegen und dem
Untergang von Großmächten, die zu ihrer Zeit weltbewegend schienen. Und regelmäßig
wurden sie von Zeitgenossen zu historischen „Wendepunkten“ erklärt. Der markanteste
Fall in der Geschichte der Neuzeit ist die Französische Revolution, die die
monarchische Ordnung der Alten Welt grundlegend infrage stellte. „In zwei
Minuten wurde das Werk von Jahrhunderten umgestürzt“, jubelte der französische
Revolutionär und Schriftsteller Louis-Sébastien Mercier im Jahr 1789. „Paläste
und Häuser zerstört, Kirchen umgestürzt, ihre Gewölbe eingerissen.“ Selbst
die Kritiker der revolutionären Umwälzungen versuchten nicht, ihre
tiefgreifende historische Bedeutung zu leugnen. „Alle Umstände
zusammengenommen, ist die Französische Revolution das Erstaunenswerteste, was
sich bisher auf der Welt zugetragen hat“, erkannte der konservative Denker Edmund
Burke 1790 an. „Alles scheint unnatürlich an diesem seltsamen Chaos aus
Leichtfertigkeit und Wildheit und mannigfachen Verbrechen, die hier vermengt
sind.“ G. W. F. Hegel hielt in seinen Vorlesungen zur Geschichtsphilosophie fest,
die er zwischen 1822 und 1831, nur wenige Jahrzehnte nach dem Sturm auf die
Bastille, an der Universität Berlin hielt, dass die Bedeutung der
Französischen Revolution „als welthistorische zu betrachten“ gewesen sei. Die
Wirren der revolutionären Ära, so waren sich Zeitgenossen einig, seien ein
kritischer historischer Scheidepunkt gewesen.
Auch die
Turbulenzen von 1848 in Europa (und darüber hinaus) wurden weithin als
Wendepunkt betrachtet. Revolutionäre auf dem ganzen Kontinent feierten eine
neue Ära des nationalen Erwachens. Ebenso wurden die Jahre des Ersten Weltkriegs von den Zeitgenossen als Wendepunkt der Menschheit angesehen.
Woodrow Wilson beschrieb ihn als einen Kampf, der „die Welt für die Demokratie
sicher machen“ würde; H. G. Wells nannte ihn den „Krieg, um alle Kriege zu
beenden“. Nach der Russischen Revolution von 1917 erklärte Lenin, die Zeit sei
gekommen, für Revolutionäre in „allen Ländern und Nationen der Welt“, den Lauf
der Geschichte zu ändern – zum Guten, wie er dachte.
Der Zweite Weltkrieg als „Finest Hour“
Die damals begangenen Fehler – vom missglückten
Versailler Vertrag bis zum fehlkonzipierten Völkerbund – ebneten jedoch den Weg für
die nächste Katastrophe, die wiederum als Wendepunkt verstanden wurde, beziehungsweise von den Alliierten als „finest hour“, in der der Kampf
zwischen Demokratie und Tyrannei entschieden würde. Das Ende dieses Zweiten Weltkriegs – gefolgt
von der Gründung der Vereinten Nationen, des Bretton-Woods-Systems, der Nato
und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl – wurde folgerichtig im Westen als
eine neue Ära gefeiert, die den Weg zum Wohlstand ebnen würde. Sie erreichte ihren Höhepunkt im Fall der Mauer, nach dem der US-Politologe Francis Fukuyama wiederum das „Ende der Geschichte“ gekommen sah. Doch der
Siegeszug des Liberalismus wurde bald durch ein Wiedererstarken des globalen Islamismus,
ein autokratisches China und ein revanchistisches Russland infrage gestellt.
Die Anschläge vom 11. September wurden von vielen Zeitgenossen als ein weiterer
Wendepunkt angesehen. „Für Amerika war der 11. September mehr als eine
Tragödie“, bemerkte George W. Bush, „er veränderte unsere Sicht auf die Welt.“
Im
Allgemeinen sind Wendepunkte wichtige Ereignisse in der Geschichte, die unser
Leben grundlegend verändern. Eines ihrer zentralen Merkmale ist ihre Unumkehrbarkeit,
da es anschließend unmöglich erscheint, zum zurückzukehren.
Es überrascht nicht, dass Politiker in Vergangenheit und Gegenwart regelmäßig –
und oft mit großer Dringlichkeit – vor vermeintlichen Wendepunkten gewarnt
haben, um so Unterstützung für ihre Sache zu mobilisieren. Dies ermöglichte es
ihnen zudem, ihrer eigenen Zeit (und sich selbst als Akteuren oder Zeitzeugen)
historische Bedeutung zu verleihen.
Insgesamt
heißt dies nicht, dass wir Wendepunkte in Geschichte und Gegenwart nicht
ernst nehmen sollten. Wichtige Momente in der Geschichte hatten irreversible
Konsequenzen. Und dennoch sollten wir achtsam sein, uns nicht zu sehr auf einzelne
Ereignisse zu fokussieren. Tatsächlich birgt die Fixierung auf vermeintliche
Wendepunkte die Gefahr, ihre tieferen Ursachen zu übersehen. Um sie wirklich zu
verstehen, müssen wir einen nüchternen Blick auf die ihnen zugrunde liegenden
strukturellen Umwälzungen werfen. Am Ende sind „Wendepunkte“ immer bestenfalls
optische Markierungen an der Oberfläche, der „Schaum“ auf der Welle der
Geschichte, wie es der Historiker Fernand Braudel einmal nannte. Die großen Richtungsänderungen, die tektonischen Verschiebungen, sind immer eher Prozesse, die sich über
Jahrzehnte hinweg entwickeln und dann in
bestimmten Ereignissen – oder Wendepunkten – sichtbar werden.