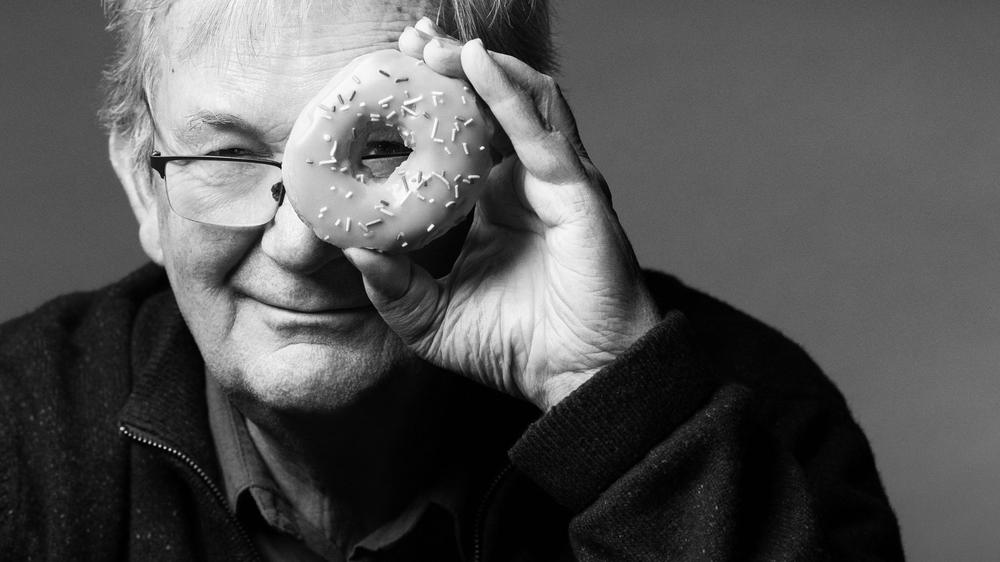Die beiden machen so eine Art Totenwettbewerb, als sie sich kennenlernen. Die Frage ist: Wer von ihnen war gestorbener, lebloser damals, im Jahr 2000 in Leipzig, als sie sich trafen und zu lieben begannen. Er sagt: „Bevor ich dich traf, war ich tot. Mein Schwanz war tot.“ Sie sagt: „Ich war toter als du, Tosch.“ Zwei Leichen lebten so dahin, beide in Ehegefängnissen lebendig begraben. Dann treffen sie sich in Leipzig, im Literaturinstitut, er, 49, arrivierter Schriftsteller und ihr Lehrer, sie, 30, Mutter, putzwütig, sich selbst hassend, ihr Leben „von mir selbst versaut, fertig“.
Sie macht Prüfung bei ihm, er gibt ihr eine Eins, lädt sie zum Essen und Schnapstrinken ein, „ab dem dritten schmeckte es phänomenal“, schreibt sie. Und: „Als wir die Kneipe verließen, griff ich Tosch zwischen die Beine. Das war neu.“
Das Leben fängt an. Noch einmal neu. Oder überhaupt zum ersten Mal. Das ist die Liebesgeschichte der 1970 in Leipzig geborenen Ich-Erzählerin mit Tosch, 1950 in Zug in der Schweiz geborener, erfolgreicher, katholischer Schriftsteller. Es ist die Geschichte, die Katja Oskamp in ihrem neuen Roman erzählt. Es ist ihr Leben, in einen Roman verwandelt, die Geschichte ihrer zweiten Geburt, die Geschichte ihrer Liebe zu dem Schriftsteller Thomas Hürlimann. Es ist eine Enthüllung. Eine Offenbarung. Ein, so scheint es beim Lesen, ganz und gar aufrichtiges Buch ohne Schonung. Ohne Schonung ihrer selbst, ohne Schonung für Tosch. „Das einzige Kriterium“, sagt Katja Oskamp, als wir uns zum Gespräch im Café Sibylle in der Berliner Karl-Marx-Allee treffen, „ist Genauigkeit.“ Ihr künstlerisches Programm: „Nicht weichzeichnen. Nicht verschmieren.“ Sie selbst wolle sich beim Lesen immer spiegeln, in den Geschichten der anderen. Und das sei nur möglich, wenn man „gnadenlos“ erzählt.
„Tosch legte mich vor dem Joseph Pub mit Krawumm auf die Motorhaube eines parkenden Autos. Er stellte den Anschluss an die her, die ich vor der Geburt meines Kindes gewesen war. Ich half mit, wo ich konnte.“ So geht die Geschichte weiter nach ihrem Griff zwischen seine Beine und ihrem Staunen über sich selbst. Eine rasante, leidenschaftliche, außerordentlich sexfreudige, tabufreie Liebesgeschichte beginnt. Sie steht von Anfang an auf zwei Säulen: „Sex und Text“. Und diese Säulen stehen in einem direkten Zusammenhang zueinander. Die körperliche führt zur dichterischen Befreiung. Ehrlichkeit, Direktheit, Offenheit, Offenbarung geheimster Leidenschaften. Sich selbst im Gespräch und im Spiel und in der Zuneigung zum anderen erstmals ganz kennenzulernen. Sich selbst anzunehmen, auch mit den dunklen, gesellschaftlich peinlichen Seiten. Und dies einander zu erzählen und dann aufzuschreiben. „Wir begleiteten unser Sexualleben verbaltheoretisch“, schreibt Katja Oskamp. „Verbalpraktisch“ würde es eigentlich besser treffen. Denn das ist das Tolle und Besondere und auch Neue an dem Buch: Es ist im gleichen Maße, in dem es eine Liebesgeschichte ist, auch eine Künstlerinnengeschichte. Schritt für Schritt und Akt für Akt sind wir dabei, wie eine junge Frau, die aus lauter Selbsthass und Ekel und angenommener Nichtswürdigkeit eine Putzmanie entwickelt hat und nur noch sich selbst wegputzen möchte, wie diese Frau zu sich selbst findet und zu ihrer Geschichte.
Eine Frau wird zur Schriftstellerin, und sie lässt nicht einen Moment einen Zweifel daran aufkommen, wem sie das verdankt: Tosch und immer wieder Tosch. „Er hat mich zur Schriftstellerin gemacht“, schreibt sie im Roman. Drei Jahre nach ihrem Zusammenkommen veröffentlicht sie ihren ersten Erzählungsband über ihre Jugend in der DDR. Im neuen Roman bleibt er ohne Titel, aber damals hieß er und war ein viel beachtetes Debüt. Und das ist ja heute fast die Regel, dass junge Autorinnen und Autoren, vor allem wenn sie an einem Schreibinstitut lernen, am Anfang einen Mentor haben, der sie in die Spur schickt. Der den entscheidenden Impuls gibt. Bei Katja Oskamp – der Romanfigur und der lebendigen hier im Café Sibylle – war es aber so, dass sie dankbar und freudig abhängig blieb von ihrem Lehrer. Von Tosch. Von Hürlimann. Kein Satz ohne ihn, vier Bücher lang. Nur einen Porno, den sie unter Pseudonym veröffentlichte und ihm später schenkte, gegen Ende ihrer Beziehung, als es ihm schon sehr schlecht ging und Sex längst nicht mehr möglich war, hat sie ohne ihn geschrieben. Aber vier Bücher lang war er für sie unverzichtbarer Berater, Ermutiger, Verwerfer. Ohne ihn, dachte sie, ist sie gar keine Schriftstellerin: „Tosch liebte meine Texte und meinen Hintern. Ich liebte Toschs Pranken und sein Lektorat. Virtuos jonglierten wir mit dem Auftrag, uns einander auf Gedeih und Verderb zuzumuten mit allen Meisen und Absonderlichkeiten.“ Sex und Text waren scheinbar unauflöslich ineinander verwoben. Körper und Sätze. „Tosch sollte schalten und walten. Über beides. Und das tat er.“
Das scheint auf den ersten Blick nicht ganz leicht miteinander vereinbar: diese freie, selbstbewusste, hell und lachend berlinernde Katja Oskamp im Café Sibylle und diese Selbstbeschreibung als unselbstständige, genieabhängige Halbautorin. Aber in Wahrheit ist das ja das echte Selbstbewusstsein: dieses Bekenntnis zur eigenen Ungeniehaftigkeit. Zur Mühsal des Schreibens, zur Qual, zur Gemeinschaftlichkeit. Dieses offene Sprechen über das, was man gemeinhin eine Schwäche nennen könnte, macht Katja Oskamp zu einer starken Frau und zu einer Autorin mit einem glasklaren, unverdrucksten Stil.