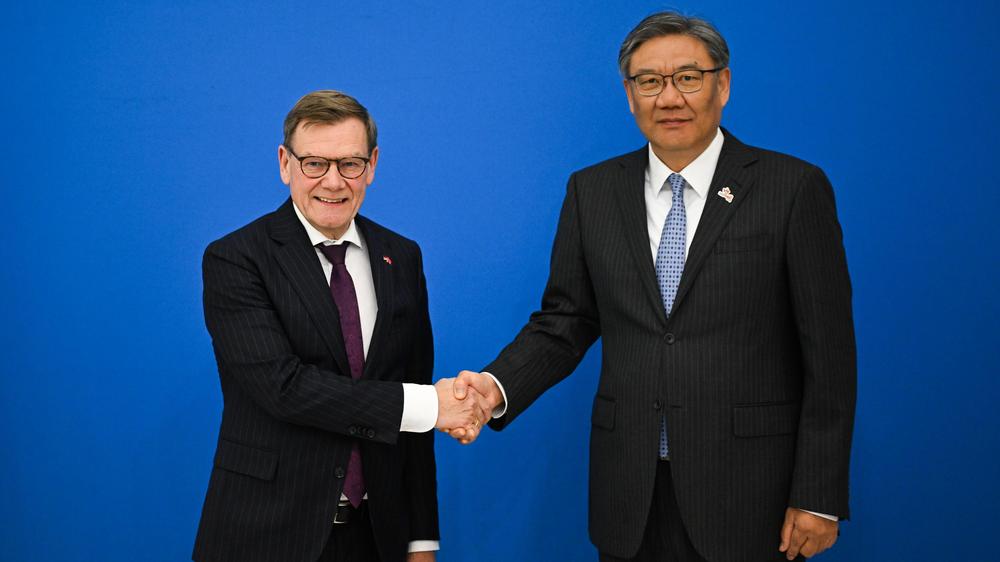An einem Nachmittag im August kommt ein Mann im blauen Funktionsshirt in
ein Warschauer Café. Zwischen den hippen
anderen Besuchern fällt er sofort auf. Er stellt sich als Wladislaw Ammosow
vor, Offizier aus der russischen Region Jakutien. Zehn Monate habe er in der
Ukraine gekämpft – gegen Russland, sein Heimatland.
Er zeigt Bilder auf seinem
Handy, von seinem Feldbett, von sich auf einem Panzer und vor einem Schriftzug
in der ukrainischen Stadt Kramatorsk. 15 Jahre habe er in der russischen
Armee gedient, sich zum Kämpfer ausbilden lassen. Als Russland die Ukraine
angriff, habe er vor der Wahl gestanden: gegen die Ukraine und sein Gewissen
oder gegen Russland kämpfen. Dann habe er vom Warschauer Zivilrat gehört und sei drei
Wochen später schon in der Ukraine gewesen, so erzählt er es.
Der Zivilrat wurde in Warschau von
Exiloppositionellen gegründet. Wer sich als Russe der ukrainischen Armee
anschließen will, dem bietet die Organisation die nötige Hilfe: Papiere,
Kontakte, Vorbereitung und die Organisation der Einreise. „Das System Putin
kann man nur mit Gewalt stoppen“, sagt Anastasia Sergejewa, die seit der
Gründung 2022 für den Zivilrat arbeitet. Sie trägt ein beigefarbenes Kleid mit
Schmetterlingen, wir treffen sie ebenfalls in einem Warschauer Café, weil sich ihre Organisation durch Spenden finanziert und sich derzeit kein Büro leistet. Man sehe sich
als Anlaufstelle für alle, die bereit seien, am „militärischen Widerstand“
teilzunehmen, sagt Sergejewa.
Offen den Krieg kritisiert
Dafür kooperiert der Zivilrat mit einem umstrittenen Akteur: dem Russischen Freiwilligenkorps RDK, eine für die
Ukraine kämpfende Einheit unter Führung des
russischen Neonazis Denis Nikitin. Im März, vor der russischen Präsidentenwahl, machte der RDK weltweit Schlagzeilen mit der
Behauptung, nach Russland eingedrungen zu sein und dort Dörfer eingenommen zu
haben. In Propagandavideos riefen die Kämpfer andere Russen dazu auf, sich dem
Kampf gegen Putin anzuschließen. Die Rechtsextremen des RDK seien die einzige
Einheit, denen sie russische Freiwillige vermitteln könnten, sagt Sergejewa und
sieht in der Zusammenarbeit kein Problem: „Der RDK kämpft auf der richtigen
Seite, also verdient er Unterstützung.“
Der Zivilrat steht außerdem im Kontakt mit
ukrainischen Behörden und übernimmt die Verifikation der Freiwilligen, prüft in
Vorgesprächen deren Motive. Diese Interviews führt Denis Sokolow, der im Café neben
Anastasia Sergejewa sitzt. Sokolow
kann sagen, was für Menschen sich beim Zivilrat melden, um gegen ihr eigenes
Land zu kämpfen.
Zwei große Gruppen gebe es. Die erste
bestehe aus Russen mit ukrainischen Wurzeln, die im Zuge des russischen
Angriffs ihre ukrainische Identität entdeckt hätten. Sie suchten die
Gelegenheit, sich von Russland zu lösen und „Ukrainer zu werden“. Viele von
ihnen hätten im Privatleben Konflikte; mit ihrer Familie, die sich nicht
ukrainisch fühle, oder mit dem Arbeitgeber, weil sie als einzige offen den
Krieg kritisierten.
„Auf der Suche nach sich selbst“
Die andere Gruppe sei in gewisser Weise „auf
der Suche nach sich selbst“. Es seien Menschen, die sich nicht mehr im Spiegel
ansehen könnten, die es nicht ertragen könnten, was ihr Land tue. Die meisten
davon seien alleinstehend, hätten in Russland keine Zukunft und im Leben
nichts mehr zu verlieren. Auf der richtigen Seite der Geschichte zu kämpfen,
sähen sie als die letzte Chance, ihrem Leben doch noch Sinn zu geben. Geld sei
bei keinem der Rekruten eine Motivation. Viele hätten gar nicht erwartet, dass
sie fürs Kämpfen überhaupt einen Sold bekommen.
Sokolow versuche in den Gesprächen herauszuhören, ob seinem Gegenüber klar ist, worauf er sich einlässt; dass
der Krieg in der Regel ein Albtraum sei und das ukrainische Militär „keine
Elfenarmee“, wie er sagt. Wer einen alternativen Weg habe, dem rate er, diesen
einzuschlagen. Er erzählt von einem jungen Russen, der es schon nach Europa
geschafft hatte und sich nicht ausreden ließ, in der Ukraine kämpfen zu gehen.
Er habe es dann aber keine drei Tage im Schlachtfeld ausgehalten.
Interviews führen gehörte zum Alltag in
Sokolows altem Leben, in Russland. Eigentlich ist er Wissenschaftler, forschte
als Sozialanthropologe zu islamistischen Extremisten in Dagestan und
Tschetschenien – instabile Regionen, die das Regime in Moskau mit harter Hand ruhig hält.
Weil er durch seine Arbeit enge Kontakte zu extremistischen Gruppen hielt, sei Sokolow
irgendwann für den Geheimdienst FSB interessant geworden. Er weigerte sich, zu
kooperieren, und schrieb gleichzeitig Aufsätze für westliche Thinktanks.
Seiner Verhaftung ging er zuvor, in dem er 2018 Russland verließ, so erzählt er
es.