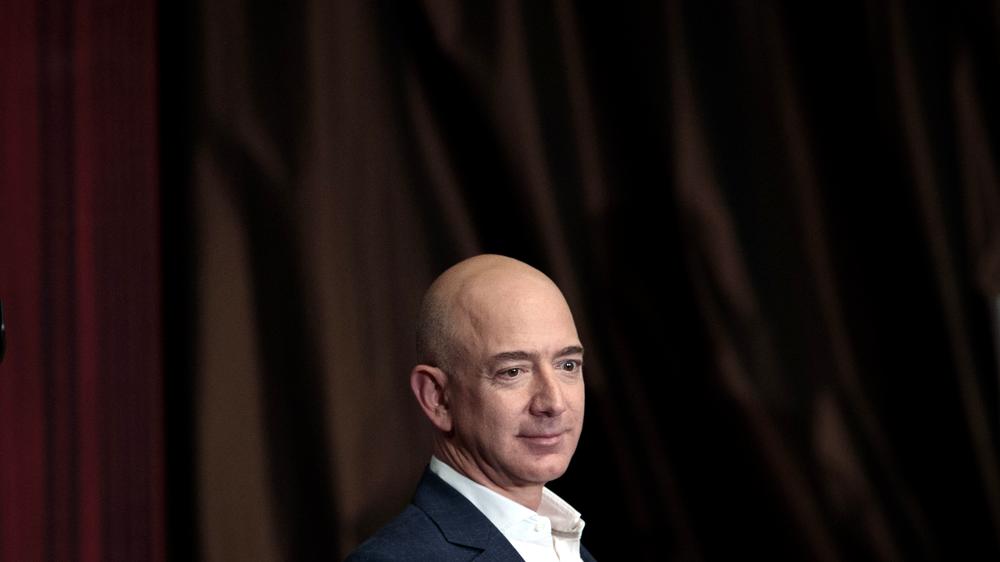Man darf sofort skeptisch sein, wenn ein Kommentar in einem
englischsprachigen Medium ankündigt, den Lesern werde nun gleich eine „“ mitgeteilt. Eine angeblich schwer verdauliche Wahrheit auszusprechen, ist
eine Diskursfigur, die eine fragwürdige, zumindest bereits wertende Behauptung
enthält: Die Öffentlichkeit und damit Medien drückten sich um manche
Gewissheiten herum, weil sie unangenehm für sie seien. Das vermeintliche Tabu,
das mit dem Aussprechen gebrochen werden soll, ist aber oft gar keines. Und die
Position desjenigen, der etwas angeblich Unbequemes artikuliert, wird allein
deshalb nicht objektiver, weil er das angeblich Unbequeme als unbequem
bezeichnet.
Jeff Bezos ist Milliardär, Gründer des Versandhandels
Amazon, der Weltraumfirma Blue Origin und seit 2013 alleiniger Besitzer der
ehrwürdigen Tageszeitung . Es gibt vermutlich viele Menschen,
die Bezos unterstellen, eigene und eben gewichtige Interessen zu verfolgen,
also keine per se objektive Stimme zu sein. Dass er so betrachtet wird, gibt
Bezos auch gleich in einem Kommentar zu, den er unter dem Titel „“ nun in seiner eigenen Zeitung geschrieben
hat.
Darin begründet Bezos seine Entscheidung, dass die
entgegen früherer Usancen vor der aktuellen
US-Präsidentschaftswahl keine Wahlempfehlung abgeben wird. „Geht es um den
Anschein von Interessenkonflikten, bin ich kein idealer Besitzer der „,
schreibt Bezos. „Jeden Tag trifft sich irgendwo ein Amazon- oder
Blue-Origin-Manager oder jemand von anderen Firmen oder gemeinnützigen
Organisationen, die ich betreibe, mit einem Behördenvertreter.“ An seine
Leserinnen und Leser gewandt führt er fort: „Sie können meinen Reichtum und
meine Geschäftsinteressen als Schutz gegen Einschüchterung betrachten oder als
ein Netz von widerstrebenden Interessen.“ Will sagen: Jeff Bezos wird es als
Unternehmer auf die ein oder andere Weise mit Vertretern der kommenden
Regierung zu tun bekommen, womöglich kann es ihm deshalb nicht ganz egal sein,
ob Kamala Harris oder Donald Trump die
Wahl gewinnt.
Dass Bezos überhaupt in der etwas schreibt,
ist ein seltener und seltsamer Moment. Bezos war bislang peinlich auf den
Anschein bedacht, sich als Besitzer der aus allen
redaktionellen Entscheidungen herauszuhalten. Er hat dort bislang eigentlich
keine Texte publiziert. Nun hat er beides getan. Und offenkundig fühlte sich Bezos gezwungen, den
Verzicht auf eine Wahlempfehlung öffentlich zu begründen (die der Zeitung seit
der Verkündung am vergangenen Freitag angeblich schon 200.000 Abo-Abbestellungen eingehandelt hat, dabei bleibt die doch eine fantastische Zeitung). Die
Entscheidung, keinen politischen Favoriten zu nennen, kann man zunächst einfach so richtig
finden. Die wesentliche Aufgabe von Medien ist es, über die Mächtigen zu
berichten, und nicht, eine Empfehlung auszusprechen, wer der nächste mächtigste
Mensch im Staate sein sollte. Jeff Bezos benutzt für diese Meinung in seinem
Kommentar jedoch weitgehend die falschen Argumente.
Er schreibt etwa, das Wahlergebnis in den USA werde nicht
dadurch beeinflusst, welche Empfehlung vorher eine Zeitung ausgesprochen habe.
Das stimmt vermutlich, ist aber nicht einmal ein Argument. Es ist nur eine
Feststellung, zu der man sich als Medium verhalten kann.
Schwerwiegender und aus Bezos‘ Sicht offenbar schwer verdaulicher für Journalistinnen und Journalisten ist seine Behauptung,
es gebe einen Zusammenhang zwischen der in den USA bislang üblichen
Zeitungspraxis der Wahlempfehlungen und einer in vielen Studien
tatsächlich auch weltweit nachgewiesenen Vertrauenskrise in Medien. Solche, die ihren
Leserinnen und Lesern eine Kandidatin, einen Kandidaten für die Präsidentschaft
ans Herz legen, bestätigen laut Bezos einen Verdacht: Medien seien politisch
voreingenommen. Keine Wahlempfehlungen mehr auszusprechen, räume diesen
Verdacht zwar nicht aus, sei aber eine Voraussetzung dafür, dass Menschen
wieder mehr Vertrauen in Medien fassen würden. „Wir () müssen korrekt berichten, und man muss uns glauben, dass wir korrekt
berichten“, schreibt Bezos. „Leider versagen wir bei der zweiten Bedingung.“
Beide Bedingungen sind nachvollziehbar, die zweite zu erfüllen, nämlich wie man gelesen (oder angeschaut oder angehört wird), liegt jedoch wesentlich beim Leser, Betrachter, bei der Zuhörerin. In der Hinsicht ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Instituts Gallup interessant, die im Text von Bezos verlinkt ist, auf die er aber gar nicht eingeht. Sie belegt nicht nur die Vertrauenskrise der Medien bei den Bürgerinnen und Bürgern der USA, sondern auch etwas anderes: Wie vertrauenswürdig die Befragten Medien finden, hängt wesentlich davon ab, für welche Partei sie Sympathien hegen. Bei Wählern der
Demokraten antworten 54 Prozent, sie hätten ein Grundvertrauen in Medien, bei
Wählern der Republikaner sind es lediglich zwölf Prozent. Man kann das so deuten, dass Anhänger von Donald Trump ihre Meinungen nicht ausreichend in Medien repräsentiert sehen. Nur gibt es in den USA ein überreiches Angebot an Fernsehsendern, Radiosendungen und Podcasts, die nichts anderes als Trumps Gospel singen, und auch die veröffentlicht konservative Meinungen. Viel näher liegt da die Vermutung, dass das Grundmisstrauen gegen jedwede Institution (vielleicht mit Ausnahme des Militärs und der Polizei) bei Republikanern derart verbreitet ist, dass es fast schon egal ist, wie und was Medien veröffentlichen: Es wird an dem tief sitzenden Misstrauen gegen die Institution Presse auf der einen Seite des politischen Spektrums nichts ändern.
Ein paar viel näherliegende Gründe hätte es auch noch gegeben, dass eine Zeitung vielleicht keine Wahlempfehlungen aussprechen sollte. Frühere – etwa auch der für Joe Biden im Jahr 2020 – enthielten ausführliche Charakterbeschreibungen des dann empfohlenen Kandidaten wie seines Widerparts, die man schon in einer üblichen journalistischen Kommentierung fragwürdig finden könnte und schon gar in einem solchen quasi-offiziellen . Beriefe man sich stattdessen etwa bei der aktuellen Wahl auf den Inhalt der Wahlprogramme, käme man bei einem Vergleich der von Trump und Harris zum Ergebnis: Das gerade einmal 16-seitige Programm der Republikaner (PDF) enthält im Gegensatz zum berüchtigten, total ausufernden Regierungsplan „Project 2025“ (von dem sich Trump mittlerweile distanziert) des konservativen Thinktanks Heritage Foundation quasi nichts Konkretes, das man mit dem ausführlichen Harris-Wahlprogramm (PDF) vergleichen könnte. Und was überhaupt könnte eine Wahlempfehlung noch enthalten, was nicht ohnehin in der täglichen Medienberichterstattung über den US-Wahlkampf nicht längst gesagt worden wäre? Zumal eine Wahlempfehlung, und das ist aber eher für Journalistinnen und Journalisten wesentlich, im Namen ganzer Redaktionen ausgesprochen wird: Was, wenn man als Redakteur, als Redakteurin die empfohlene Kandidatin, den empfohlenen Kandidaten für ungeeignet hält?
Zu all diesen „“ hätte man gern mehr von Jeff Bezos gelesen. Nur ist er, und das ist wirklich kein Vorwurf, kein Journalist. Er ist Besitzer einer Zeitung. Und von denen erwartet man zu Recht, dass sie keine redaktionellen Entscheidungen treffen. Dann müssen sie diese übrigens auch gar nicht erst begründen.