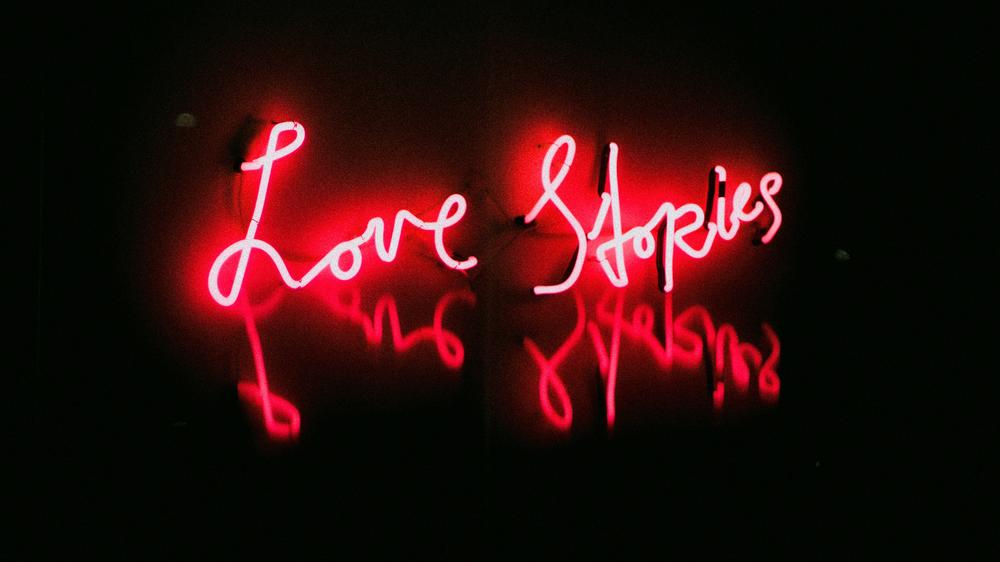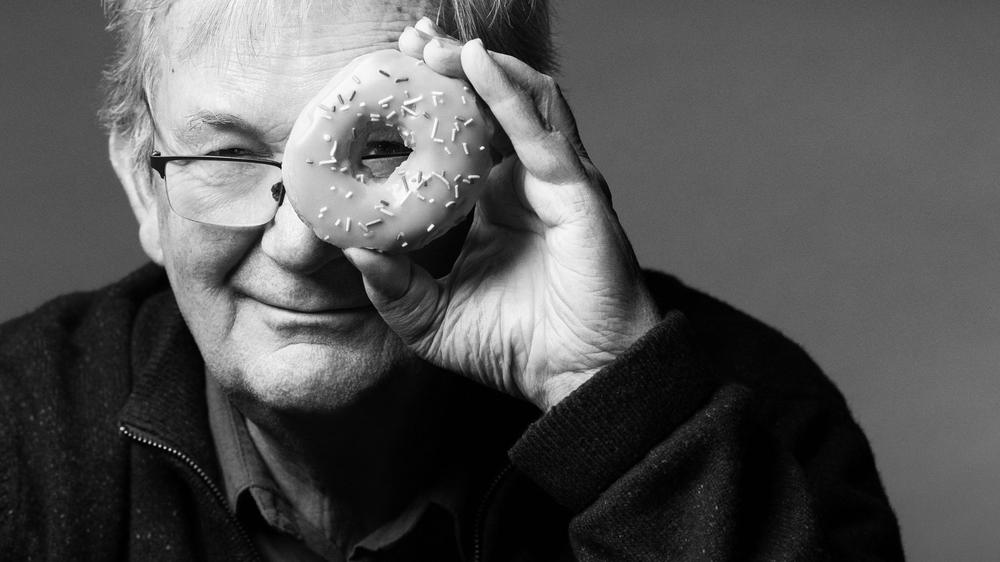Der Wels hat niemandem etwas getan, und trotzdem hat er im Englischen einen schrecklichen Ruf: Denn ein Catfish ist eine Person, die auf Tinder und Co. fremde Fotos verwendet, sich als jemand anders ausgibt, um Menschen in Onlineromanzen und Betrugsfallen zu locken. Für den Wels rufschädigend, für Männer ärgerlich, für Frauen mitunter sogar Gefahr für Leib und Leben.
Doch der Wels war nur der Anfang. Wenn es nach den Dating-Apps geht, könnte man diese Form der Unauthentizität auch institutionalisieren – dank KI! Und in abgeschwächter Form natürlich. Wie die berichtet, arbeiten fast alle Mainstream-Apps daran, KI auf die ein oder andere Weise in ihre Produkte zu integrieren. Schon bald könnte es also ein Chatbot sein, der einem mittelmäßigen Pick-up-Lines schickt, Orte für ein Date vorschlägt, die Profilfotos kuratiert und Kurzbiografien verfasst.
Damit möchte die Onlinedating-Industrie die sogenannte bekämpfen, eine gewisse Grundmüdigkeit, mit der besonders die Gen Z inzwischen auf das ewige Swipen und Matchen und die eingepreiste Unverbindlichkeit blickt. Die globalen App-Downloads sind seit dem Höhepunkt der Pandemie gesunken und mit ihnen die Aktienpreise der Unternehmen dahinter. Künstliche Intelligenz soll Abhilfe schaffen, Investoren überzeugen und den Nutzern zum digitalen Dating-Coach werden, zum „Wingman“, wie die LGBTQ-Dating-App Grindr ihren KI-Helfer nennt.
Dabei scheint das Problem jedoch eigentlich woanders zu liegen. Laut einer Umfrage in begründen Nutzer ihre mit der häufigen Ablehnung, den Schwierigkeiten, eine echte Verbindung herzustellen, dem Konkurrenzdruck und der Enttäuschung, wenn jemand lügt oder nicht mehr schreibt. Die Einführung künstlicher Intelligenz scheint hier Pflaster auf der Fleischwunde, ein Fix, der eben eher dafür gedacht scheint, den Investoren zu signalisieren, dass man das Problem im Griff hat, als den Nutzern ehrlich zu helfen.
Denn Tinder und Co. sind womöglich nicht mal sonderlich motiviert, eine dauerhafte Lösung zu finden, ist eine gewisse Grundenttäuschung in ihrer Nutzerbasis doch gut fürs Geschäft. Denn ihr Geld verdienen sie nicht mit den glücklichen Paaren (die es gibt!), die sich auf den Plattformen kennenlernen, um diese dann (hoffentlich) prompt zu verlassen, sondern mit den Zurückgebliebenen, Geschmähten. Ihnen können sie dann als Mittel gegen ihre Enttäuschung Boosts und Abonnements verkaufen, die mehr Sichtbarkeit, Matches und damit Erfolg versprechen. Diese Kunden sind fast ausschließlich Männer. Auf Tinder, der größten aller Dating-Apps, machen sie sowieso drei Viertel der Nutzer aus, jedoch sogar 96 Prozent der Zahlenden.
Selbst Flirten sieht die Techbranche als technisches Problem
Das liegt wohl daran, dass sie mehr Abweisung erfahren. Entgegen den misogynen Erzählungen gekränkter, weil matchloser Typen online ist das jedoch nicht die Schuld arroganter Frauen, sondern direkte Folge des App-Designs. Tinder und Co. versprechen ein Übermaß an möglichen Partnerinnen und Partnern. Das ergibt also automatisch viel Konkurrenz, gespaltene Aufmerksamkeit und regelmäßige Ablehnung. Männer trifft das mehr als Frauen, weil sie einerseits in der Überzahl sind, und andererseits Frauen wählerischer matchen, weil sie sich vor übergriffigem Verhalten und Belästigung schützen müssen. Doch selbst wenn der letzte Punkt kein Faktor wäre: Es passt nun einmal nur eine gewisse Anzahl an Chats und Dates in eine Woche, das ist nicht die Schuld der Nutzer(innen). Für die ständige Enttäuschung gilt also, wie man so schön sagt:
Kann KI also solche Enttäuschungen reduzieren? Vielleicht wenigstens insofern, als ab und zu mal mehr als ein „hi“ als erste Nachricht geschrieben wird – das wäre in reiner Privatempirie ein absoluter Fortschritt. Doch gibt es eine grundlegende Spannung zwischen dem, was KI bietet, und dem, was Dating-Apps vorgeben zu sein. Denn ein Flirt ist deswegen besonders wegen der Zeit und der Aufmerksamkeit, der Intentionalität und dem Interesse, welche man dem Gegenüber entgegenbringt. KI ist die Antithese zu alledem.
Diesen Prozess zu automatisieren, also die Notwendigkeit für all diese Aspekte zu minimieren, entspricht der Weltsicht des Silicon Valley, die annimmt, es gebe keine Schwierigkeit auf Erden, die sich nicht durch Algorithmen, Interfaces und Computercode lösen ließe. Es ist die mathematisch-mechanische Perspektive der Programmierer und Ingenieure – für jeden Topf einen Deckel, für jedes Problem eine App. Diesem Denken geht es nur um Ergebnisse, der Weg ist ein Prozess ohne Eigenwert – ihn gilt es, wegzuoptimieren.
In diesem Weltbild ist der Zweck des Schreibens die mit Buchstaben gefüllte Seite, nicht das damit einhergehende Denken, der Zweck der Kunst ist das fertige Bild, keine tiefere Perspektive auf die Welt, und der Zweck des Flirts ist die Anzahl ausgetauschter Nachrichten, nicht Nervenkitzel um die mögliche Bindung. Es fühlt sich tatsächlich an wie eine abgeschwächte Form von Catfishing – assistierte Unauthentizität, die zwangsläufig mit der Realität kollidiert, sollte es tatsächlich zu einem Date kommen. Denn das wird fernab jeglicher KI-Coaches stattfinden.