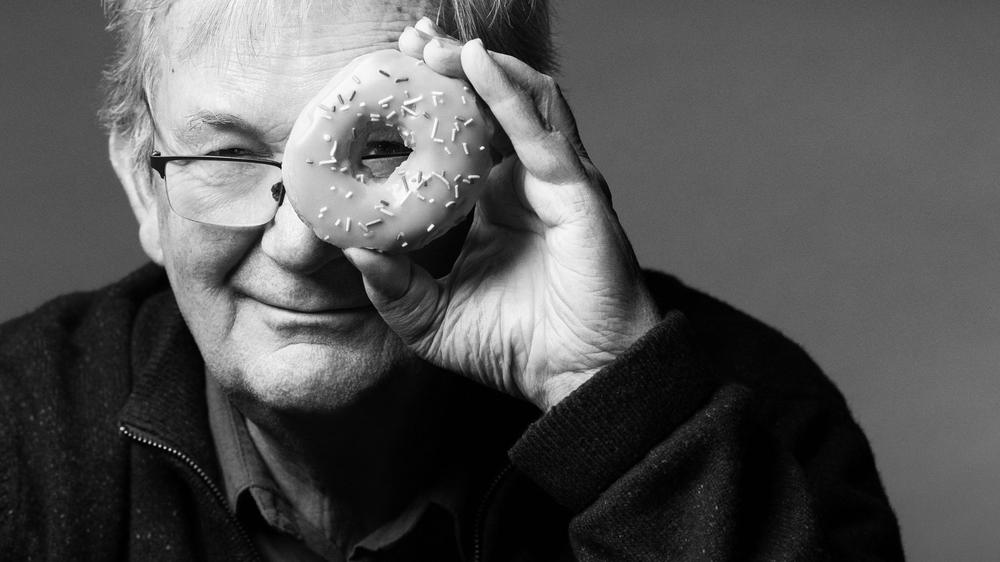Eine ikonische Fernsehaufnahme zeigt
Ende der Sechzigerjahre eine in einen Leopardenfellmantel gehüllte junge Frau.
Fast demütig bekennt sie, sie sei stolz, nun die Combo ansagen zu dürfen, die
nicht weniger als verspreche: das Sextett Brasil ’66
des Brasilianers Sérgio Mendes. Die Ansagerin ist keine geringere als die
Jazzdiva Eartha Kitt. Wenn auch der neue Sound des von ihr präsentierten Songs ein Welterfolg werden sollte, der jahrzehntelang zuverlässig
die Tanzflächen füllte, so erntete doch auch der neue Look der Band einige
Aufmerksamkeit.
Schon Instrumentierung und Line-up
waren ungewöhnlich: Am Grand Piano mit Beatnik-Bart und Clubjackett der
Bandleader Sérgio Mendes, dahinter aufgereiht sein Ensemble: Bob Matthews am
Kontrabass, João Palma mit Beatles-Frisur an den Drums, daneben schwenkt José
Soares die Ganzá, das brasilianischen Schüttelrohr, wie einen Cocktailshaker. Flankiert
wird er von den silbrig miniberockten Sängerinnen Lani Hall und Karen Phillip,
die zwar im Hintergrund stehen, aber den Vordergrundgesang beisteuern.
Nicht zum Ende kommen
Das von Jorge Ben komponierte , dessen salopper Titel so viel oder so wenig bedeutet wie „Ach, was
soll’s“, beschwört im Text den Sog des eigenen Songs: „Du willst nicht, dass
ich zum Ende komme.“ Einer, der das Ende der Performance in der Oper von
Chicago kaum erwarten konnte, soll der demokratische Senator Robert
Kennedy gewesen
sein. Allerdings war es wohl eher der Look, der den Politiker interessierte,
denn er suchte nach dem Konzert im Jahr 1968 nicht etwa den Arrangeur des neuen
Sounds auf, sondern die Garderobe der Sängerin Karen Phillips. Nach eigener
Darstellung ging sie auf die zudringliche Offerte nicht ein, auch aus Angst, in
seiner Nähe zum Ziel von Attacken zu werden, womöglich gar eines Attentats. Kennedys
Bruder John Fitzgerald, Martin Luther King und Malcolm X hatte es schon erwischt
und wenige Monate nach dem Zwischenspiel in der Künstlergarderobe wurde auch Robert
Kennedy von einer Kugel niedergestreckt.
Die Zeiten, in denen Brasil ’66 sich
aufschwang, den größten Einfluss auf den Popmarkt nach den Beatles zu nehmen,
wie der Musikhistoriker Ruy Castro urteilt, waren politisch düster, nicht nur
in den USA, sondern auch in ihrer südamerikanischen Heimat. Sérgio Mendes‘
Musik war es nicht. , sein größter Erfolg, rauscht in einem
Crescendo heran wie eine warme Meeresbrise, das chorisch gesungene
(Hurra) echot triumphierend und zwingt mindestens zum Mitwippen. In der dritten
Strophe des portugiesischen Textes heißt es übersetzt: „Diese Samba, die mit
Maracatu gemischt ist, ist die Samba des alten Schwarzen.“ Damit ordnete sich
der neue Sound gleich selbst musikhistorisch ein, denn er entstammte zwei Genres
mit afrobrasilianischen .