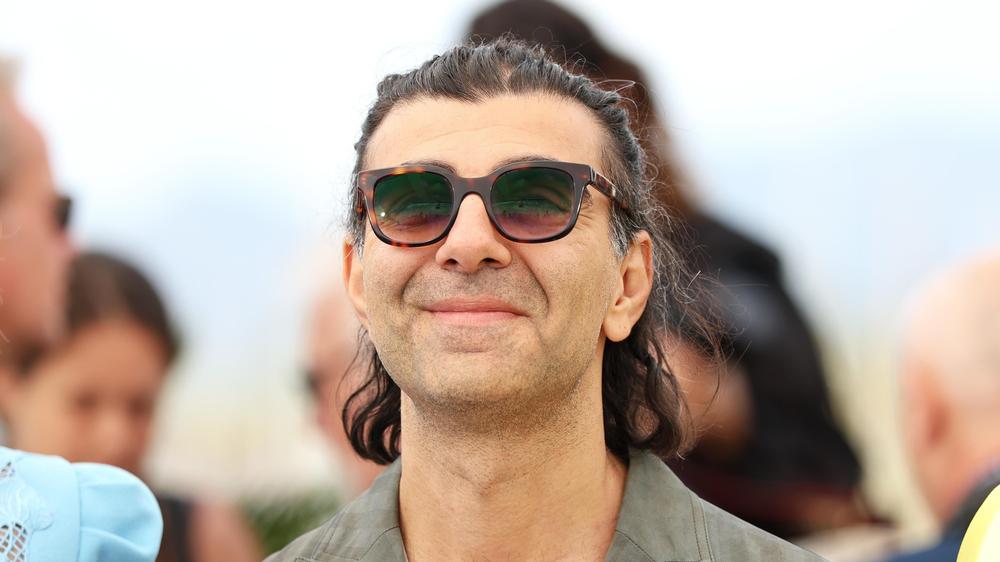ZEIT ONLINE: beruht auf den Kindheitserinnerungen des deutschen Regisseurs, Schauspielers und Produzenten Hark Bohm, den Sie
immer wieder als Ihren Mentor bezeichnet haben. War er für Sie auch ein Lehrer in deutscher Geschichte?
Fatih Akin: Erst mal hatte Hark meine Bewerbung für
den Studiengang Film an der Universität in Hamburg abgelehnt. Deswegen habe ich an der
Kunsthochschule studiert. Später fragte er, ob ich bei ihm unterrichten könne, so haben wir uns kennengelernt und wurden Freunde. Hat er mich auch in deutscher
Geschichte unterrichtet? Ja
natürlich, weil er mir immer
wieder von seinen Eltern erzählte, die Nazis
waren.
Ich weiß um seinen Zwiespalt, sie dennoch zu lieben. Ich weiß, wie er aufwuchs
und was ihn
politisierte. Er hat mir sein sehr persönliches Deutschlandbild vermittelt. Hark gehörte
zu der Gang des Neuen Deutschen
Films, die ihn kinematografisch
erzogen
hatte. Diese Filmschaffenden warfen einen sehr kritischen Blick auf Deutschland. Und natürlich
hat er auch viel über Rainer Werner Fassbinder gesprochen.
ZEIT ONLINE: spielt 1945 kurz vor
Kriegsende. Der Film nimmt die Perspektive des zwölfjährigen Nanning ein. Er unterstützt seine Mutter tatkräftig, die damit beschäftigt ist, die Familie über Wasser
zu halten. Wie haben Sie sich seinem Blick genähert?
Akin: Hark sagte: „Du wirst das gut erzählen können, wegen deiner Sommerurlaube in der Türkei. Du kommst zwar aus
einer deutschen Großstadt, dort funktioniert die Heizung, das warme Wasser kommt aus der Leitung, im Supermarkt gibt es 50 verschiedene Sorten Butter. Aber dann kommst du in ein türkisches
Dorf, holst Wasser
aus dem Brunnen und gehst fischen, damit etwas zu
essen auf den Tisch kommt.“ So sind meine Cousins groß geworden, die ich in den
Ferien begleitet habe – ein großes
Abenteuer! Diese Erfahrungen konnte ich in den Film mit einfließen lassen. Und sie
decken sich mit dem Erleben von Nanning, der aus Hamburg nach Amrum kommt.
Deshalb wird Nanning von Einheimischen als Festländer bezeichnet und auch
gemobbt.
ZEIT ONLINE: Zu Hause wiederum wird er mit unterschiedlichen politischen
Haltungen konfrontiert. Seine Mutter, eine glühende Nationalsozialistin, fällt nach der deutschen Kapitulation in eine
Depression. Ihre Schwester, mit der sie das Haus teilt, ist wiederum antifaschistisch
eingestellt. Spiegelt sich in unsere Gesellschaft, das viel
beschriebene zerrissene Land?
Akin: Jeder Fünfte hat in Deutschland die AfD gewählt, die sind nicht mehr irgendwo da hinten. Diese Zerrissenheit geht durch Familien, durch Freundeskreise. Man kann sich
seine Familie nicht aussuchen und man kann sie sich
auch nicht wegschneiden. Dafür gibt
es Wahlverwandtschaften, die sehr kostbar sind. Das alles erlebt Nanning. Mir
war wichtig, dass die Optik des Films gegenwärtig ist, kristallklar
und modern,
ohne Pixel oder Korn. Wenn die Kids das sehen, sollen sie
nicht denken:
„Ey, das ist ja von früher.“
ZEIT ONLINE: Nannings Onkel, dessen jüdische Freundin von der Familie
verraten wurde, sagt im Traum zu ihm: „Du bist nicht dafür verantwortlich, aber
du hast etwas damit zu tun.“ Haben Sie als Deutscher mit türkischen Wurzeln
eine andere Perspektive auf Deutschland, die deutsche Schuld?
Akin: Ich kann
dir ’ne türkische Familie in
Deutschland oder Gangster-Iraner-Rapper-Familien einfach so erzählen Aber diese deutsche Familiengeschichte zu erzählen, war für mich die
größte Herausforderung. Meine Frau Monique ist halb deutsch. Ihr Vater
wuchs im Dittmarschen auf, das zwischen
Hamburg und Amrum liegt. Ich habe wahnsinnig viel Zeit in dieser weitverzweigten Familie verbracht. Ich habe keinen Zweifel, dass einige die AfD wählen. So eine Gemengelage
in der Vergangenheit ohne Klischees zu erzählen, war schwer. Moniques Großmutter
wurde 104 Jahre alt, sie war
eine Zeitzeugin. Mir wurde irgendwann klar, dass ich den Film zwischen der
Familie meiner Frau und Edgar Reitz‘ -Trilogie ansiedeln muss. Das war meine Strategie. „Du bist nicht dafür
verantwortlich, aber du hast etwas damit zu tun“ – ohne diesen Satz hätte ich
keinen Film.
ZEIT ONLINE: Noch ein
Satz aus dem Film: „Jeder wahre Amrumer verlässt die Insel“, so heißt es über
die Menschen, die weggingen, Walfänger wurden, in die USA auswanderten. Da wird
noch mal klar, dass Deutschland auch ein Auswanderungsland war …
Akin: Amrum war
schon immer ein kosmopolitischer Ort. In meinen Filmen, sei es in
oder in , geht es immer wieder um Menschen, die von A nach B
gehen. Hark Bohm verließ die Insel, und seinen Kindheitsfreund Hermann, der
auch im Film vorkommt, habe ich während des Drehs auf Amrum kennengelernt. Der
wohnt inzwischen seit 60 Jahren auf Long Island. Amrum war
immer ein bisschen wie Irland: ein zu armer oder zu karger Ort, um dort zu bleiben. Und andersherum kamen, wie man im Film sieht, die Vertriebenen aus den
ehemaligen Ostgebieten, aus Schlesien dorthin. Da fragen sich die eingesessenen
Kinder: „Sind das Deutsche, sprechen die Deutsch?“ Ja, das sind Deutsche. .
ZEIT ONLINE: Wenn man einen historischen Stoff verfilmt, besteht immer die Gefahr
der Musealisierung. Wie haben Sie es
visuell geschafft, dass Amrum nicht zum Heimatmuseum auf
der Leinwand wird?
Akin: Mein Kameramann und
ich haben uns viel an Gemälden, etwa von Caspar David
Friedrich, orientiert. Auch
Abenteurerromane wie Mark Twains und Daniel
Defoes waren eine Referenz. Die Frage war: Wie kann ich romantisch erzählen, ohne in Nostalgie zu versinken? Bei der Ausstattung wird es immer gefährlich, wenn
die Ausstatter zu viel wollen oder
wenn ein Kostüm zu viel will. Nichts sollte sich in den Vordergrund drängen. Denn wenn ich einen Film mache über diese Zeit, dann sollte ich versuchen, sie möglichst direkt ins Heute zu übersetzen.
ZEIT ONLINE: Sind das
eigentlich Walrippen, die vor dem Haus von Nannings Familie eine Pforte bilden?
Akin: Ja, weil es eine Familie von Walfischfängern ist, wie es dort ganz viele gibt. Hark Bohm hat das ins Drehbuch eingebaut, und der Ausstatter hat
einen Vorschlag gemacht. Diese
Wahlrippen haben mir aus einem ganz einfachen visuellen
Grund gefallen: Man erkennt das Haus immer, auch von Weitem.
ZEIT ONLINE: Laura Tonke,
Detlef Buck, Matthias Schweighöfer – Ihre
Schauspieler bewohnen die Insel aufs Lebendigste. Wie haben Sie in Ihrem
Ensemble dieses Amrum-Gefühl erzeugt?
Akin: Ich bin viel nach Amrum gereist. Ich bin eng befreundet mit Hark, und bei Hark ist immer alles Amrum. Das schwappt dann
natürlich über, auch auf das Ensemble. Als ich dort war, ist
mir die Sprache, der nordfriesische Dialekt Öömrang aufgefallen. Ich dachte,
was sprechen die denn da? Hark sagte, er verstehe es, aber er könne es nicht sprechen. Man hört diesen Dialekt im Alltag immer noch
unter den Amrumern. Also wollte ich ihn im Film
haben. Und ich glaube, das war auch
für das Ensemble etwas Entscheidendes.
ZEIT ONLINE: In Ihrem
Film kämpfte die Figur von Diane Krüger gegen den NSU, in
spielt Krüger eine Nazigegnerin. Geht so der Widerstand im Kino
weiter?
Akin: Ja, und das entsteht
durch ihre Person.
Wir
setzen uns gemeinsam mit unserer Heimat auseinander und mit den Feinden der
Freiheit unserer Heimat. Ich sagte zu ihr: „Ey, Diane, ich hab‘ Schwierigkeiten, den Film zu finanzieren, hättest du Lust mitzumachen?“ Sie meinte,
sie habe nicht viel Zeit, aber: „Diese
Bäuerin und Nazigegnerin da, hast du die schon besetzt?“ Die wollte sie spielen, wie eine Fortsetzung von Katja in
. Diane ist
wie Robert
De Niro in und das wird mit
Sicherheit nicht der letzte Film sein, den wir beide in Angriff nehmen.