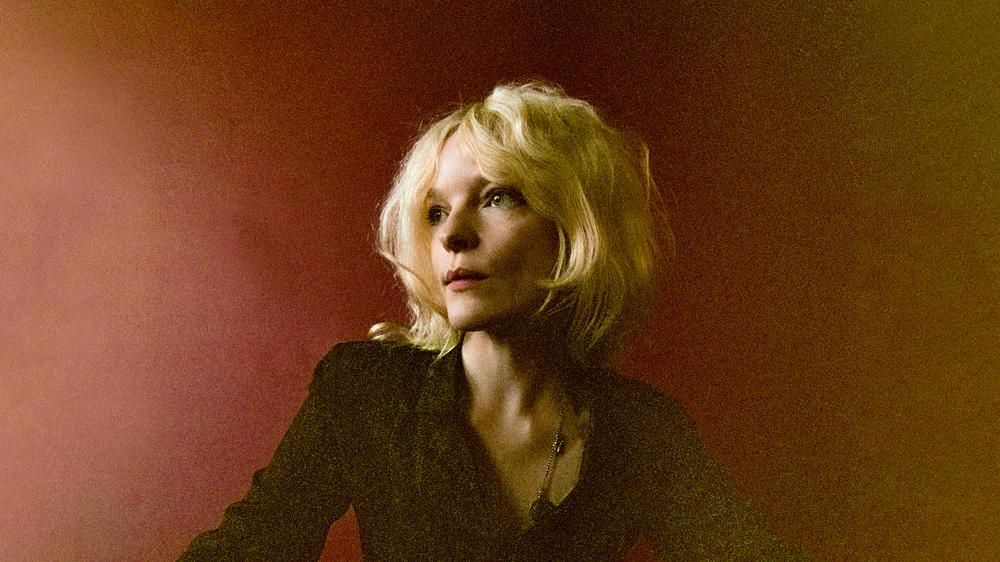Jessica Pratt ist noch gar nicht aus dem Auto
gestiegen, aber schon ganz bei Thomas Mann. „Ich habe bisher nur von ihm gelesen“, sagt sie, „aber das hat mich als
Teenagerin nachhaltig geprägt. Es ist so schön und doch so abgefuckt.“ Die
Musikerin lebt im Osten von Los Angeles, hat sich
als Treffpunkt für ihr Interview mit ZEIT ONLINE aber das 70 Autominuten
entfernte Thomas-Mann-Haus ganz im Westen von L.A. gewünscht. Pratt wohnt inzwischen seit elf Jahren in der Stadt, versteht sich allerdings noch immer
als Entdeckerin. „Viele geschichtlich relevante Orte sind in L.A. sehr gut
versteckt“, sagt sie. „Man kommt hier nicht zufällig vorbei. Man muss
schon wissen, wo sich das Haus befindet, und dann hoffen, dass einem die Tür
geöffnet wird.“
Seit sie ihr viertes Album veröffentlicht
hat, erscheint in Los Angeles gar keine Tür mehr vorstellbar, die Jessica Pratt
nicht offenstünde. Die Platte wurde von Publikum und Musikpresse euphorisch
aufgenommen, berühmte Kollegen wie Troye Sivan sampelten ältere Stücke von
Pratt, und Chanel kaufte ihre Musik für eine Fashionshow ein. Eigene Konzerte
der Künstlerin sind in Nordamerika und Europa ausverkauft, bei einem
Gastauftritt in der Hollywood Bowl sang sie kürzlich an der Seite von Beck Hansen. Ihr bisher größter Vorstoß in den Mainstream ist zugleich
Pratts erste auf Tonträger verewigte Kooperation: Mit dem Rapper Asap Rocky,
hierzulande vor allem bekannt als Partner von Rihanna, und dem Grammy-Gewinner
Jon Batiste nahm Pratt den Song auf.
Die Karriere der 37-Jährigen – sie wuchs nördlich von
San Francisco im für Kalifornien ungewöhnlich konservativen Redding auf – erzählt
die Geschichte eines Aufstiegs zu eigenen Bedingungen. Vor der Veröffentlichung
ihres ersten, unbetitelten Albums im Jahr 2012 hatte Pratt eigentlich keine
Pläne, jene Songs, die sie seit ihrer Teenagerzeit geschrieben hatte, herauszubringen.
„An so etwas wie die Zukunft habe ich überhaupt nicht gedacht“, sagt
sie. Freundinnen trieben sie jedoch dazu an, Konzerte zu spielen und einige ihrer
Lieder doch einmal aufzunehmen. „Für diese Freundinnen war meine Musik dann
auch gedacht. Ich hielt sie für die Ewigkeit fest, glaubte aber nicht, dass
sich irgendjemand außerhalb meines Zirkels dafür interessieren würde.“
Zwei Wochen nach der Veröffentlichung von hatte die Musikerin bereits alle 500 gepressten LPs verkauft. Sie zog
nach Los Angeles, wie so viele Leute, die es ernst meinen mit der Kunst, tat es
jedoch nicht nur aus künstlerischen Gründen. Pratts Mutter war gerade gestorben
und eine langjährige Beziehung zu Ende gegangen, sie sehnte sich auch nach
räumlicher Veränderung. Ohne Freundinnen und Führerschein ging sie also in die
Stadt der Autofahrer. „Ich stand unter Schock“, sagt Pratt,
„sonst hätte ich das nie gemacht. In Los Angeles braucht man
eigentlich Bekannte und eine gute Grundlage, um zu überleben.“
Den Führerschein hat Pratt bis heute nicht gemacht,
dafür aber mehr als nur ein paar Bekannte gefunden: Ihr Lebensgefährte und
langjähriger Mitmusiker Matt McDermott chauffiert sie zum Interview nach Pacific
Palisades. Auch Los Angeles selbst wurde zu einer Freundin von Pratt, aus der
sie heute große Inspiration zieht. „Als ich in L.A. ankam, bin ich einfach
stundenlang spazieren gegangen“, erinnert sie sich. „Oder ich habe
den wirklich ineffizienten Nahverkehr genutzt und mich Bus für Bus durch die
Stadt gehangelt.“ Selbst eine rissige Wand mit Müllhaufen davor könne in
Los Angeles anregend aussehen, sagt Pratt. „Wie das Licht hier alles in
Szene setzt und seine Schatten wirft: Das verleiht Los Angeles seine
unwirklichen Texturen.“
Die Spannung zwischen Licht und Schatten, Glitzern und
Düsternis prägt auch Pratts Songs. Schon auf ihrem ersten Album, das noch vor
dem Umzug entstanden ist, klangen jene
Elemente, die Pratts Sound bis heute ausmachen, an: verhuschter Gesang und
bluesige Gitarre, Texte, die trotz karger Instrumentierung kaum zu verstehen
sind, aber doch Intimität evozieren. Pratt hat diesen Sound im Verlauf ihrer
folgenden Alben weiter verfeinert: Auf spielt sie mit
Bossa-Nova-inspirierten Rhythmen, die sich wie ausgebleichte Erinnerungen eines
früheren Los Angeles über die Songs legen. „Während der Aufnahmen habe ich
unter anderem Bücher über L.A. in den Sechzigerjahren gelesen“, sagt
Pratt. „Darunter auch einige über Charles Manson und seinen Kult.“
Nur bei oberflächlicher Betrachtung kann man diese
Lektüre für unpassend halten. Jessica Pratt mag zurückgenommene, mitunter auch
zurückhaltende Songs schreiben, vielleicht sogar jene Schlaflieder, die ihr hin
und wieder in Rezensionen unterstellt werden. Hinter den Fassaden ihrer Stücke
warten jedoch präzise Beobachtungen aus einer Stadt und einem Land, die Pratt
schon seit Längerem als „paranoid“ empfindet. Orte und deren
Geschichten prägen diese Beobachtungen ebenso wie Pratts eigene Erfahrungen.
„Deshalb wollte ich das Interview auch unbedingt im Thomas-Mann-Haus
führen“, sagt sie. „Wenn man einen solchen Ort entdeckt und seine
Geschichte erforscht, ist das wirklich ein faszinierender Prozess.“