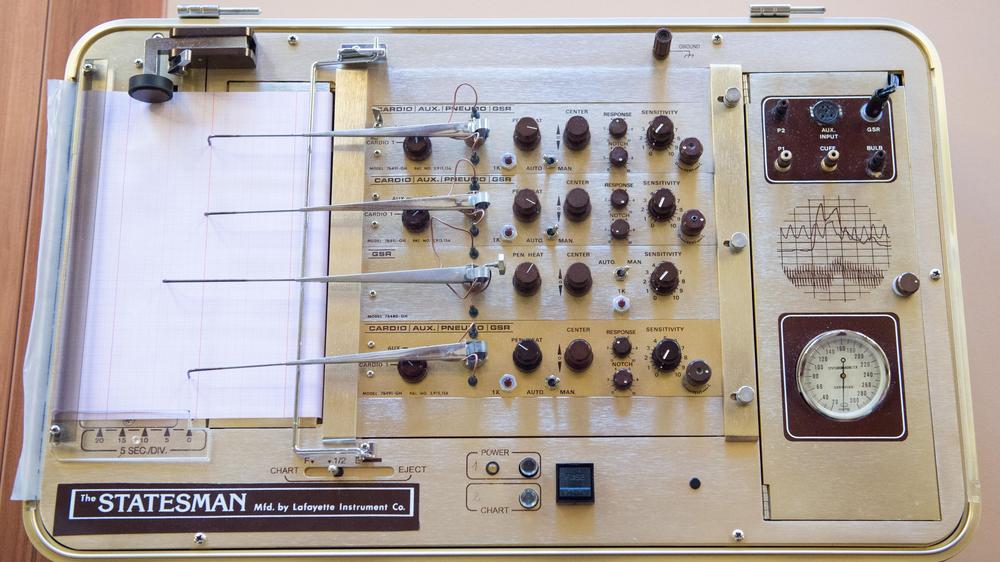Die Geschichte hat sich mit dem Amtsantritt von Donald Trump schlagartig beschleunigt, und die Europäische Union versucht, der schnellen Abfolge
von Ereignissen hinterherzukommen. Das tut sie auf ihre Weise. Man trifft sich
häufiger als sonst, um die Lage zu diskutieren und die eigene Politik
anzupassen. Die 27 Staats- und Regierungschefs haben sich am Donnerstag bereits
zum zweiten Gipfel innerhalb eines Monats getroffen.
Wenn auch die Tagesordnung variiert, kann man doch festhalten,
dass auf beiden Gipfeln auf ein Thema eine Antwort gesucht wurde: Wie können wir uns in diesen sich radikal
verändernden geopolitischen Lagen verteidigungsfähig machen? Wie kann die EU
bestehen, wenn die USA sich von Europa abwenden und Wladimir Putin seinen
Kriegszielen in der Ukraine näherkommt? Eigentlich fast alles, was in der EU derzeit diskutiert wird, dreht sich um diese Fragen.
Beim Gipfel am Donnerstag ging es in erster Linie um
die Wettbewerbsfähigkeit der EU. Das betonte Ratspräsident António Costa bei der
Abschlusskonferenz. Aber die neben ihm stehende Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fügte sinngemäß hinzu: Wettbewerbsfähigkeit sei ein Teil von
Verteidigung. Weil die EU immer gut darin ist, Ziele zu formulieren, tat sie es
auch auf diesem Gipfel. Ein neues Ziel heißt: Readiness 2030.
Widerstand in Italien und Spanien
Man will also bis 2030 so weit sein, dass man
allen Kriegsgefahren und Krisen wirksam begegnen kann. Dazu soll auch das
Weißbuch Verteidigung dienen, das den Gipfelteilnehmern vorgestellt wurde.
kann man durchaus mit dem treffenderen deutschen Wort „kriegstüchtig“
übersetzen.
Allerdings sind sich die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union in Sachen Krieg nicht einig. Trotz aller gemeinsamen verfassten
Bekenntnisse, der Ukraine unerschütterlich beistehen zu wollen, gibt es
innerhalb der Union recht große Meinungsverschiedenheiten. Das wird an verschiedenen Stellen deutlich.
Italien und Spanien etwa können sich mit dem Begriff ReArm
Europe nicht anfreunden. Unter diesem von Ursula von der Leyen ausgegebenen
Slogan versteht man die Beschlüsse, die am 6. März bei einem Sondergipfel in
Brüssel gefasst wurden. Dabei geht es um die Mobilisierung von insgesamt 800
Milliarden Euro, um Europa aufzurüsten.
In Italien und Spanien stoßen diese Aufrüstungspläne auf großen Widerstand, in der Bevölkerung wie auch in den regierenden Parteien und
der Opposition. In beiden Ländern wächst bei vielen die Überzeugung, dass die
„russische Gefahr“ übertrieben werde, um damit Aufrüstung zu rechtfertigen.
Putin diene da nur als Schreckgespenst, um lukrative Geschäfte mit Waffen zu
machen. Die Krisenwahrnehmung ist also eine völlig andere als etwa in Polen
oder den baltischen Staaten.