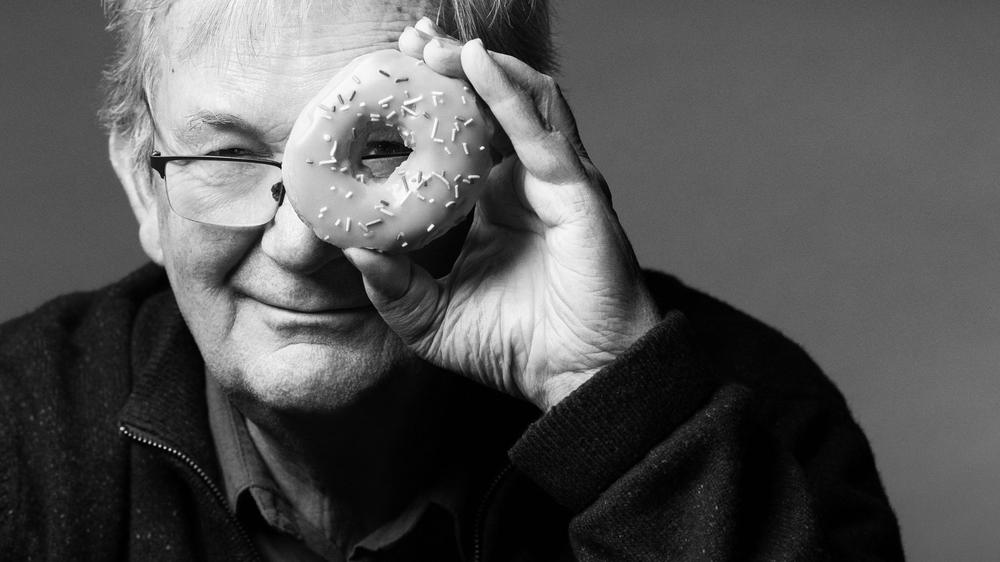„Sinsteden“, sagt der Künstler, „das ist mit das Schönste, was ich gemacht habe.“ – Und wirklich, welcher andere Ort böte die Möglichkeit eines derart umfassenden und zugleich geschlossenen Einblicks in das Werk des Bildhauers Ulrich Rückriem? Eigens hat er hier zwei Hallen für seine Kunst entworfen, für über 40 Steinarbeiten und Stein-Ensembles, ein Gesamtkunstwerk, unbelastet von allem Kunstbetrieb und -tourismus.
Sinsteden, wortgeschichtlich die „Stätte in einer Weidelandschaft“, ist ein Dorf mit gerade mal 600 Seelen, am westlichen Rand der Kölner Bucht gelegen. Eine Gegend mit fruchtbaren Böden; eine Stätte für Steinbildhauerkunst würde man hier nicht vermuten. Kein großformatiges Hinweisschild an den umliegenden Autobahnen, das auf die Skulpturenhallen hinweist, die man hier vor drei Jahrzehnten errichtet hat. Sie sind viel weniger bekannt als andere Kultureinrichtungen für Bildhauerkunst, etwa als das kanonische Lehmbruck Museum in Duisburg; als der Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal, den Tony Cragg seit 2008 fortwährend ausbaut; oder als das Museum Insel Hombroich bei Neuss mit den „begehbaren Großplastiken“ Erwin Heerichs und der nahebei gelegenen Skulpturenhalle, die Thomas Schütte vor wenigen Jahren nach eigenem Entwurf hatte bauen lassen.
Im Vergleich wirken Rückriems Hallen in Sinsteden nüchtern und lapidar, die Stahlträger sind industrielle Fertigelemente, der Boden ist bloßer Zement, die Decke unverkleidet, die Außenmauern und die eingezogenen Wände aus Kalksandstein wurden weiß getüncht. Es herrscht diffuses Obergadenlicht ohne Ausblick. Ein landwirtschaftlicher Zweckbau, möchte man meinen, ähnlich der Lagerhalle, die die Gemeinde und der Landkreis auf denselben Nutzflächen für ein Landwirtschaftsmuseum saniert hatten.
Unbetitelt, undatiert, unbezeichnet sind die Exponate, Arbeiten Rückriems aus den Jahren 1986 bis 2008: wenige einzelne Steine gibt es zu sehen, dafür zahlreiche Gruppen symmetrisch angeordneter Quader, Reliefs und Platten, teilweise gespalten oder zersägt und stets wieder zusammengefügt, Granit und Dolomit, Schiefer, Diabas und Kalkstein, häufig mit ihren schrundigen Oberflächen belassen, vielfach aber auch an einer oder mehreren Seiten poliert und geschliffen. Kein Stein gleicht dem anderen, selbst dann nicht, wenn, gleichsam introvertiert und narzisstisch, zwei polierte Sägeflächen im Abstand von wenigen Millimetern gegeneinandergekehrt sind.
Rückriems Ateliers sind die Steinbrüche. Vor Ort wählt er die Blöcke aus und bespricht mit den Abbauführern und deren Mitarbeitern die Spaltungen, die Schnitte und Schliffe, die mit den Steinsägen, Brechern und Poliermaschinen ausgeführt werden, ob in Spanien, in Finnland, England, im westfälischen Anröchte oder in der Normandie. Von dorther stammen die einzigartigen, nach einer jahrmillionenlangen Gesteinsmetamorphose bei Abbruch ockerfarbenen und nach dem Schliff ins Bläuliche changierenden Granite, genannt
Aus historischer Sicht erinnert man sich des Museumskünstlers Rückriem, etwa dass seine quadratischen Reliefplatten aus Granit im Fünfjahresabstand den Boden der Neuen Nationalgalerie in Berlin bestücken. Erinnert sich auch seiner zahlreichen Mahnmale, die in öffentlichem Auftrag an die Tatorte der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik erinnern, etwa der dezentral über den Stadtraum verteilten Stelen in Düren, eine Stunde südlich von Sinsteden, wo Rückriem zur Schule und bei einem Steinmetz in die Lehre ging. Und erinnert sich des Gebrauchskünstlers in kirchlichem Auftrag, der ein gutes Dutzend Taufsteine, Tabernakel und Altäre schuf, nicht zuletzt für den Hildesheimer Dom, wo die Proportionen des von ihm verwendeten Anröchter Steins die des ottonischen Westwerks wiederaufnehmen. Aber in Sinsteden ist all dies entsakralisiert, entpolitisiert, vielleicht sogar: entmusealisiert.