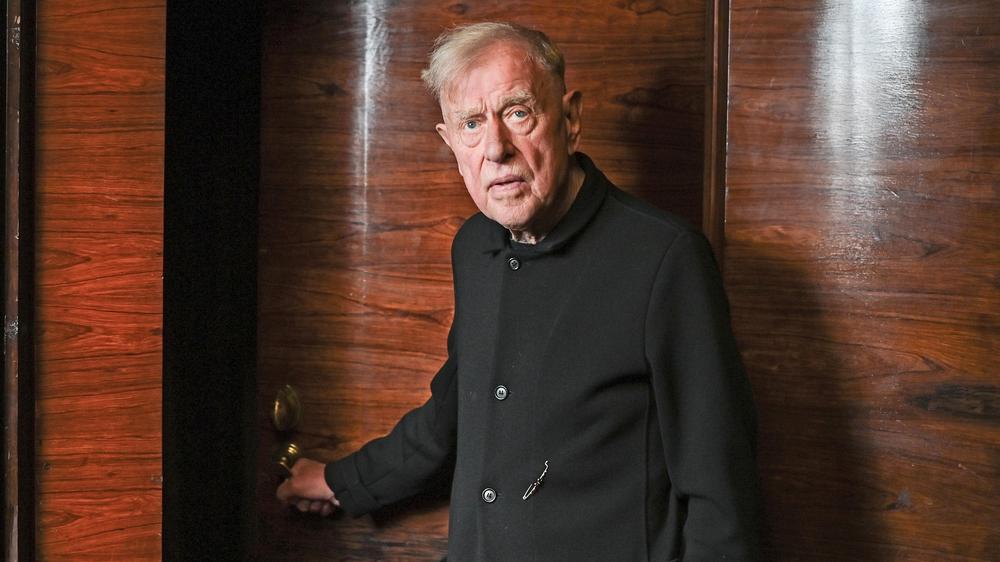Wenn Menschen ausgelassener Stimmung sind, sagen sie gern: Ich könnte die ganze Welt umarmen. Bei Claus Peymann war die Sache ein wenig
anders. Wenn er guter Laune war, hätte er die ganze Welt ohrfeigen können. Und
er war oft guter Laune. Lag ein Konflikt in der Luft, zog er ihn an sich,
spitzte ihn zu – und badete nicht ohne Genuss die Folgen aus.
Als Intendant in Stuttgart wurde er gewissermaßen zum
Staatsfeind Nummer eins ausgerufen. Er ließ damals zu, dass ans Schwarze Brett
des Theaters ein Spendenaufruf geheftet wurde, der dazu aufforderte, den
Zahnersatz der in Stammheim einsitzenden Gudrun Ensslin zu finanzieren. Er
selbst, sagte Peymann später, habe ebenfalls gespendet, um zu zeigen, dass auch
Terroristen Menschen seien. Woraufhin anonyme Briefschreiben ihn vernichten und
„vergasen“ lassen wollten.
Als Intendant in Bochum schmiss er einen jungen
Schauspieler, einen gewissen Herbert Grönemeyer, wegen Talentlosigkeit aus dem
Ensemble. Eine Tat, die er später zu seinen schlimmsten Fehlern zählte.
Und als er Intendant des Wiener Burgtheaters war, durfte er sich
rühmen, der in konservativen Kreisen am meisten gehasste Mann (der
meistgehasste Piefke sowieso) Österreichs zu sein. Die von ihm inszenierte Uraufführung
von Thomas Bernhards Stück , in dem die ganze Republik als
alpenländisches Nazinest erschien, und mehr noch ein in der ZEIT publiziertes
Interview, in dem Peymann sich selbst als genialen Regieberserker und Wien als
einen Ort des Kadavergehorsams und der grauenhaften Subordination beschrieb,
waren pures Dynamit – herrliche Anlässe nationaler Empörung.
Man könnte noch viele andere Adrenalinanekdoten aufzählen,
bei denen Peymann im Mittelpunkt stand: Invektiven gegen nahezu alle relevanten
Theatermenschen seiner Zeit (Ivan Nagel, Klaus Michael Grüber, Johannes Schaaf,
Friedrich Dürrenmatt, Rolf Hochhuth, Dieter Dorn, Elfriede Jelinek und so weiter),
Attacken gegen zahllose Politiker und Pauschalbreitseiten gegen die
Geistlosigkeit der Gegenwart. Und doch: Der Mann war, alles in allem, hoch beliebt. Mir sagte er einmal: „Es ist mir völlig klar, ich bin eine lächerliche Figur, die
sich jede Blöße gibt – und das Einzige, was mich unangreifbar macht und mich
immer neu bestätigt, ist die Liebe der Zuschauer. Gehen Sie mal mit mir durch
Stuttgart. Gehen Sie mal mit mir durchs dunkle Bochum. Und gehen Sie mal bitte
mit mir durch Wien – oder laufen Sie mit mir eines Morgens zu den Joggern im
Park zu Köpenick. Ich bin beliebt.“
Und das stimmte. Wenn man mit ihm spazieren ging, nickten ihm
wohlwollende, von der Begegnung berührte Bürger zu, entwaffnet und sogar stolz: der berühmte Herr Theaterdirektor, hier in unserer Mitte!
„Reißzahn im Arsch der Mächtigen“, der Spruch verfolgte ihn
Seine letzte Station war Berlin. Das Berliner Ensemble, das
er 18 Jahre lang leitete, von 1999 bis 2017, wollte er, so sagte er bei
Amtsantritt, zum „Reißzahn im Arsch der Mächtigen“ machen, und dieser Spruch
verfolgte ihn lange.
Der Versuch, Kontrolleur der Politik zu sein, sei in Berlin fürchterlich
in die Hose gegangen, sagte Peymann rückblickend. Warum? „Es gab keine Gegner.“
Es habe nur neoliberale Machthaber gegeben, die ein einziges Dogma gekannt hätten:
„den Profit“.
Wenn es schon keine Gegner für ihn gab, fand er dann
wenigstens Partner in der politischen Klasse?
Peymanns Antwort: ernüchternd. „Dieser Austausch“, sagte er,
„ist in Berlin gar nicht denkbar. Die breite Front der Politiker ist kulturell
eher den Banausen zuzurechnen. Die Auseinandersetzung zwischen der Macht und
der Kultur, wie man sie in Paris kennt, findet in Berlin in keiner Weise statt.
Ich habe das am BE auch nicht hinbekommen. Und das ist vielleicht mein
persönliches Scheitern als Berliner Intendant – es hätte so schön sein können!“
Auch die Berliner Theaterpolitik empfand Peymann als „Lachnummer“.
Nichtkenner, Nichtkönner, Nichtwisser bestimmten, so schimpfte er, das
Schicksal der Kultur. Konkret verhöhnte er 2015 den damaligen
Kulturstaatssekretär Tim Renner: „Wenn man Gespräche mit ihm führt, ist man
nach einer halben Stunde am Ende, es wird einem langweilig, der Mann ist ja
leer. Mit dem ist ein Gespräch gar nicht möglich. Man sitzt einem leeren,
netten weißen Hemd gegenüber.“