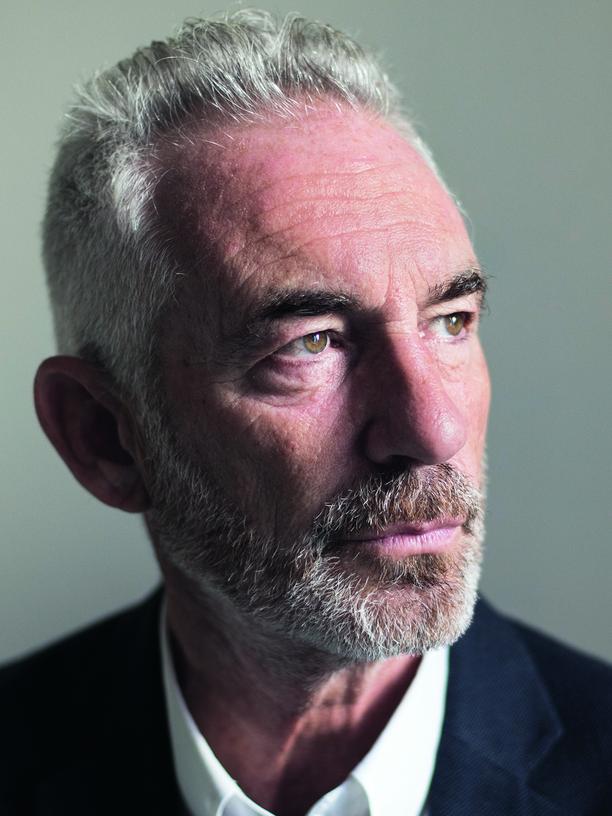ZEIT ONLINE: Tim Jackson, worüber denken Sie gerade nach?
Tim Jackson: Ich frage mich, wie wir Fürsorge zur Grundlage unserer Ökonomie machen können. Aktuell wird sie vernachlässigt, die Wirtschaft ist sorglos im doppelten Sinn des Wortes: Sie handelt rücksichtslos, und sie erschwert fürsorgliches Handeln. Um diese Missachtung der Fürsorge zu verstehen, hilft es, die Bedeutung des Begriffes zu klären.
ZEIT ONLINE: Liegt nicht auf der Hand, dass damit Hilfe für Kinder, Alte, Arme, Kranke oder Opfer von Kriegen und Katastrophen gemeint ist?
Jackson: Natürlich ist der zentrale Aspekt der Fürsorge, dass wir uns über unsere eigenen Bedürfnisse hinaus um andere kümmern. Den Altruismus, der darin steckt, bewerten wir moralisch sehr hoch. Achtsamkeit, Pflege und Zuwendung sind per se gut, so wie Liebe oder Freundschaft. Aber die Fallhöhe dieser moralischen Einordnung verhindert auch, dass wir uns eingestehen, wie sorglos unser Wirtschaftssystem handelt. Außerdem übersehen wir, dass Moral auch fragwürdige Fürsorge legitimieren kann.
ZEIT ONLINE: Wie meinen Sie das?
Jackson: Ein Arzt kann seiner Patientin fürsorglich Opium verschreiben, obwohl er weiß, dass es sie süchtig machen wird. Oder wir sorgen außenpolitisch für unsere Freunde, indem wir ihnen Bomben schicken, die dann auf die Kinder ihrer Feinde fallen. Fürsorge kann durchaus ambivalent sein. Zugleich ist sie elementar, wie wir schon aus der antiken Mythologie wissen.
ZEIT ONLINE: Was haben Sie dazu im antiken Rom und Athen gefunden?
Jackson: Es ist Cura, die Göttin der Sorge, die eine menschliche Gestalt aus Lehm formt und dann Jupiter bittet, ihr Leben einzuhauchen – worauf der mächtige Gott sein Recht reklamiert, der Figur einen Namen zu geben. Auch Terra, die Erde, sagt: „Wer aus mir hergestellt ist, der muss natürlich meinen Namen tragen.“ Cura holt Saturn als Schlichter, und der spricht Jupiter schließlich den Geist zu, Terra den Körper. „Und was kriege ich?“, fragt Cura. Darauf Saturn: „Du darfst dich um das menschliche Wesen kümmern, solange es lebt.“ Genau diese Idee, dass die Fürsorge Körper und Geist so unauffällig wie selbstverständlich zusammenhält, zieht sich seitdem durch Philosophie und Literatur, man findet es bei Martin Heidegger und auch in Goethes .
ZEIT ONLINE: Auf welche Szene spielen Sie da an?
Jackson: Als Faust von den „vier grauen Weibern“ – Not, Mangel, Schuld und Sorge – Besuch bekommt, gelingt es ihm, nur drei dieser Lasten auszusperren. Die Sorge kriecht durchs Schlüsselloch und ist wie Cura „einfach da“, so stellt sie sich vor, „stets gefunden, nie gesucht/ so geschmeichelt wie verflucht“. Wir kennen diese unsichtbare und bescheidene Präsenz, aber die Frage ist: Welche Dynamik bringt Fürsorge in Aktion? Hier kommt die Gesundheit ins Spiel. Wenn wir uns um Eltern und Kinder kümmern, dann sollen sie gesund werden oder bleiben. Gesundheit aber steht in unserem System in einem elementaren Dauerkonflikt mit der Wirtschaft.
ZEIT ONLINE: Wieso das?
Jackson: Bei der Gesundheit geht es kontinuierlich darum, einen Zustand der Balance zu finden. Atemzüge, Puls, Blutzucker, Dopaminlevel: Alles muss im Gleichgewicht sein, sonst werden wir krank. Im Prozess des Ausbalancierens sind dann Selbst- und Fürsorge die stärkenden Kräfte, die Erholung bringen. Fürsorge ist also viel mehr als Hilfe, sie ist ein Organisationsprinzip allen organischen Lebens. Dieses Prinzip ist so zentral für jedes Individuum und für die ganze Gesellschaft, dass wir damit eine Ökonomie der Fürsorge definieren können.
ZEIT ONLINE: Die meisten Menschen verstehen Gesundheit aber gar nicht als Balance, sondern als perfekten Zustand, den man erreichen muss.
Jackson: Genau darin liegt ja der Gegensatz zum Wirtschaftssystem begründet. Noch einmal: Gesundheit ist eben nicht statisch, sondern es geht, wie es der Physiologe Walter Bradford Cannon ausgedrückt hat, um die „Weisheit des Körpers“, durch die der Körper Innen und Außen inmitten sich ständig wandelnder Bedingungen immer wieder ins Gleichgewicht bringt. Das ist eher ein Tanz, und alle tanzen dabei mit, denn der Prozess des Ausbalancierens ist ohne Austausch und Beziehungen nicht denkbar. Dass wir Gesundheit stattdessen als Himmelreich betrachten, hat die Fehlkonstruktion einer Ökonomie hervorgebracht, die grundsätzlich auf Wachstum setzt.
ZEIT ONLINE: Wie hängt das zusammen?
Jackson: Wir haben beschlossen, dass das Gesundheitsparadies nur erreichbar ist, wenn wir immer mehr haben. Tatsächlich kann Wachstum ja auch dort helfen, wo Mangel herrscht – wenn wir zum Beispiel nicht genug zu essen haben. Aber der Wachstumsimperativ, dem heute alles unterliegt, dieser Zwang zum Immermehr, führt dazu, dass wir den Moment des Gleichgewichts verpassen. Längst leben wir auf Kosten anderer Menschen und der Umwelt – und das schlägt letztlich auch auf unsere Gesundheit zurück. Permanentes Wachstum passt nicht zur Balance.
ZEIT ONLINE: Andererseits: Unsere Wirtschaft wächst heute auch mit Gesundheitsdienstleistungen. In Deutschland tragen diese mit 11,4 Prozent bereits dreimal so viel zum Bruttoinlandsprodukt bei wie die Autoindustrie. Sind wir nicht schon auf dem Weg zur Fürsorgeökonomie?
Jackson: Wenn sich ein wachsender Teil der Wirtschaft um Gesundheit, Fürsorge, Zeit und Beziehungen dreht, könnte man tatsächlich sagen: Prima, dahin sollte es gehen. Wo sich Menschen um andere Menschen kümmern, wird nicht so viel Zeug produziert, gekauft und weggeworfen. Das könnte eine blühende, eine gesunde Ökonomie sein. Aber ausgerechnet die Fürsorge ist in der Gesundheitsbranche ignoriert, untergraben oder vertrieben worden. Statt sie und die natürlichen Selbstheilungskräfte zu stärken, hat sich die moderne wissenschaftliche Medizin seit dem 20. Jahrhundert vorrangig mit Keimen beschäftigt, die man ausmerzen muss. Seitdem ist unser Gesundheitssystem in wachsendem Maße abhängig von Arzneien. Es gibt Industrien und einen Markt, auf dem man hohe Gewinne und wirtschaftliches Wachstum erzielen kann.
ZEIT ONLINE: Aber man kann auch besser heilen …
Jackson: Zunächst schon. Dieses Modell, das Gesundheit wirtschaftlich interessant macht, führt aber zugleich immer neue Gifte ein, die Nebenwirkungen haben und oft sogar die Selbstheilungskräfte zerstören. Außerdem ist es hilflos gegen Krankheiten, die nicht übertragbar sind – und leider sind drei Viertel unserer Sterbefälle auf solche chronischen Krankheiten zurückzuführen. Ihre Ursachen liegen in ungesunden Lebensstilen, Fehlernährung, schlechten Arbeitsbedingungen und Umweltgiften. Gegen solche gesellschaftlichen Einflüsse hilft keine Medizin.