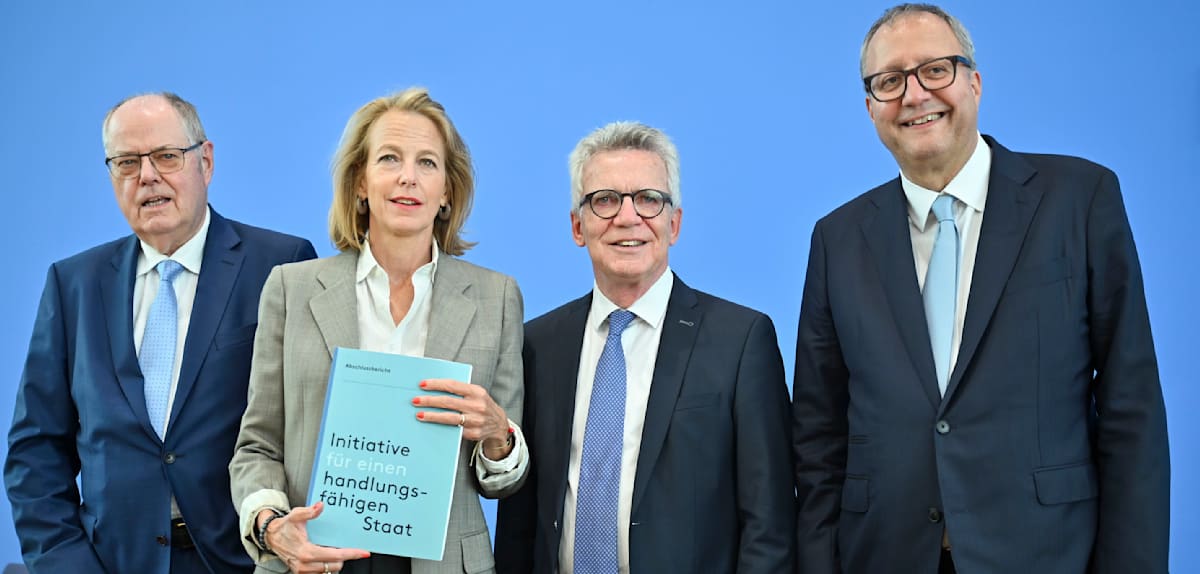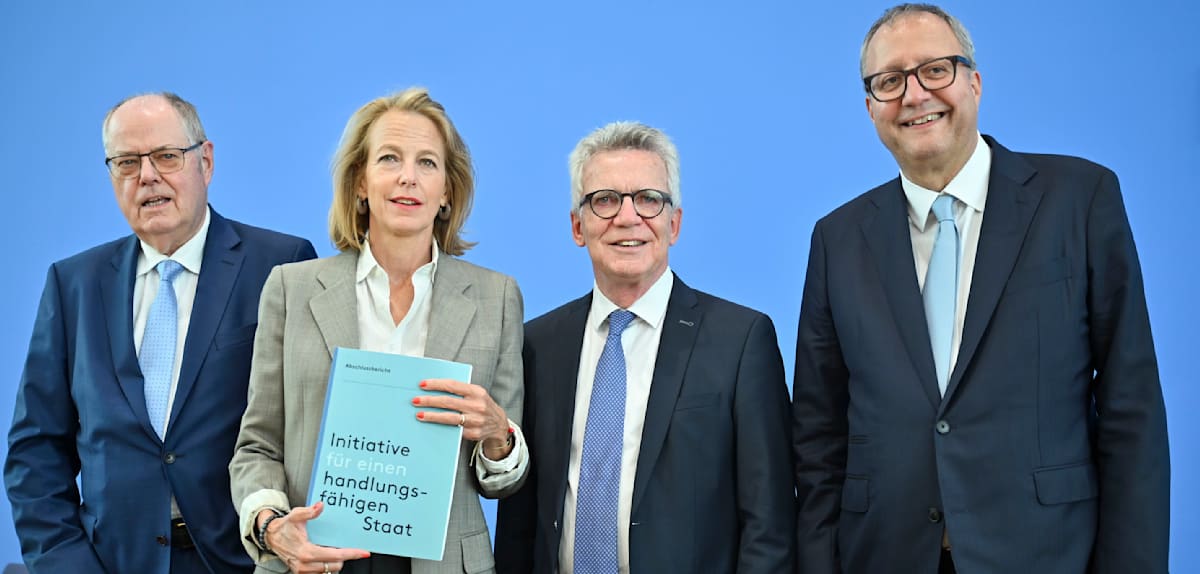Selten gibt es in Eröffnungsgrußworten von Wirtschaftskonferenzen Sätze, die es wert wären, sie zu zitieren. Aber Musalia Mudavadi, der Kabinettschef von Kenia, sagt dann doch einen Satz, der schon fast sinnbildlich für die Deutsch-Afrikanische Wirtschaftskonferenz (GABS) stehen könnte, die gerade in der kenianischen Hauptstadt Nairobi stattfindet. „Nichts ist umsonst“, sagt Mudavadi und macht eine Kunstpause.
Er meint das vor allem selbstkritisch, der Gesetzgeber in Kenia dürfe die Hürden für ausländische Investitionen nicht zu hoch legen. Aber er könnte damit auch den Redner danach gemeint haben: den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).
Habeck ist nicht nur nach Kenia gereist, um die Konferenz zu eröffnen und deutschen Firmen Türen für Geschäfte in Ostafrika zu öffnen. Eigentlich wollte der Minister auch etwas mitnehmen: Fortschritte bei der Sicherung von Rohstoffen in Afrika.
Der Kontinent ist reich an Lithium, Seltenen Erden und anderen Rohstoffen, die Industrieländer brauchen. Und Deutschland ist derzeit extrem abhängig von Lieferungen aus China. Das Problem ist: Die Chinesen waren schon lange vor Robert Habeck in Afrika, um sich auch die dortigen Vorkommen zu sichern. So kommen viele Rohstoffe gar nicht originär aus China nach Europa, sondern nehmen von Afrika aus lediglich den Umweg über die Volksrepublik.
Kommt Deutschland also zu spät? Vor dem Abflug nach Kenia wollte Habeck davon nichts wissen. „Es ist eher umgekehrt“, sagte er. „China war mal aktiv in Afrika, hat über die neue Seidenstraße-Initiative sehr viele Infrastrukturprojekte angeschoben, aber hat sich in der letzten Zeit etwas zurückgenommen, auch weil China selbst ja wirtschaftliche Probleme hat. Da wachsen auch nicht mehr die Bäume in den Himmel.“ Erwartungen an die Chinesen seien enttäuscht worden.
Deutschland soll sich durch Nachhaltigkeit abheben
Habeck hatte sich vorgenommen, stattdessen mit „Partnerschaft auf Augenhöhe“ in Afrika zu punkten. Das gelte nicht nur für die Rohstoffförderung, sondern auch für die Suche nach Arbeits- und Fachkräften. „Alte Handelspolitik, also die klassische Handelspolitik, hieß immer: Standards runter, Zölle runter, aber auch alle anderen Regularien und Standards runter, sodass (…) die ökonomisch schwächeren Länder immer den Eindruck haben, da kommt der Westen und holt sich alle Rohstoffe oder lässt uns die etwas schwierige, harte und dreckige Arbeit machen und dann nehmen sie die Rohstoffe und veredeln sie“, sagt Habeck. „So kommen wir nicht weiter.“
Deutschland könne sich von anderen Ländern abheben, indem man „soziale und ökologische Nachhaltigkeit“ anbiete. Weil Deutschland sagen könne, „wir wollen nicht zum Preis der Zerstörung eurer Wälder oder Flüsse oder eures Grundwassers Handelsbeziehungen haben, sondern wir wollen, dass ihr auch profitiert, können wir uns durchsetzen gegenüber anderen Ländern, beispielsweise China“, so der Wirtschaftsminister noch vor dem Abflug nach Afrika.
„Also Nachhaltigkeit ist nicht, wie man früher gedacht hat, ein Hemmnis in der Handelspolitik, sondern das Angebot, das wir liefern können. Die Chance für Deutschland.“
Doch nach knapp zwei Tagen in Nairobi klingt Habeck nicht mehr so optimistisch. Im Gegenteil: In den Gesprächen mit der kenianischen Regierung hätten Rohstoffabkommen gar keine Rolle mehr gespielt, räumt er ein. Stattdessen ging es um Menschenrechte, das neue Arbeitskräfteabkommen und Energie. „Kenia ist nicht das stärkste afrikanische Land, das Rohstoffe anbietet“, sagt Habeck nun in Nairobi nach den Gesprächen.
„Wir haben deswegen den Fokus des Gesprächs vor allem auf die Transformierung oder die Nutzung der Energie hier gelegt und die Investitionen, die deutsche Unternehmen tun können in diesem Bereich.“ Mit konkreten Abkommen für Rohstoffförderung oder -lieferungen hatte man im Vorfeld dem Vernehmen nach in Habecks Ministerium nicht gerechnet. Dafür ist der Weg noch zu weit, man müsste zunächst einmal ausloten, wie man gemeinsam Ressourcen fördern könnte. Rohstoffe muss Deutschland also wohl auch weiter aus China kaufen – und hoffen, dass die Chinesen zuverlässig liefern.
Philipp Vetter ist Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Für WELT berichtet er aktuell aus Kenia. Philipp Vetter schreibt außerdem über das Bundeswirtschaftsministerium, Wirtschafts-, Energie- und Verkehrspolitik.