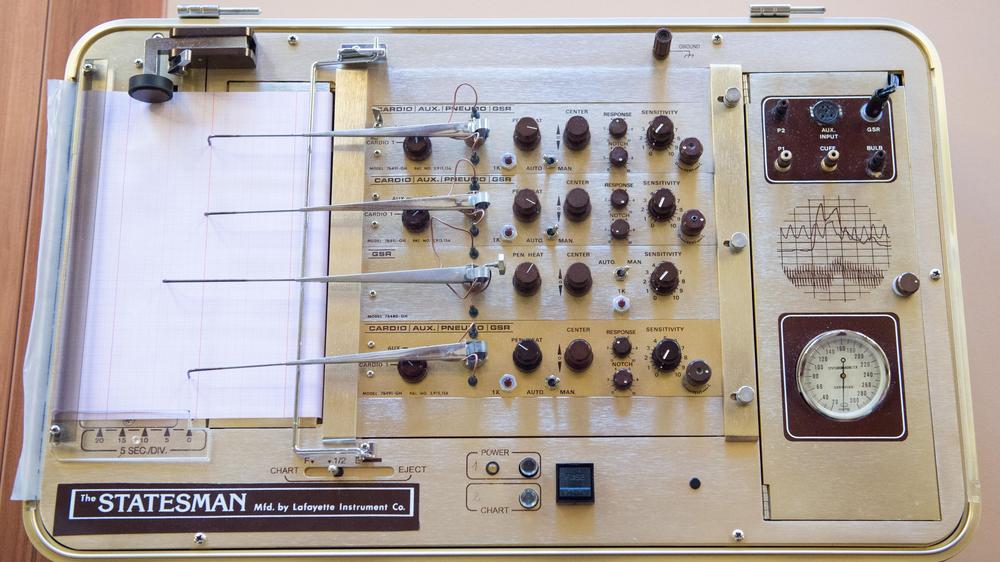So
friedlich sieht es aus, wenn Europäer sich über Waffen beugen. Die
Sonne schien, der weiße Kies war frisch geharkt. Der Ehrenhof des Élysée-Palasts lag am Montagnachmittag bereits im Schatten. Auf der
einen Seite war die Republikanische Garde aufmarschiert, eine schmucke
Ehrenformation. Auf der anderen Seite des Hofes warteten mehr als
zweihundert Journalistinnen und Journalisten.
Dann
wurden nacheinander vorgefahren: Nato-Generalsekretär Mark Rutte,
Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez, Ursula von der Leyen und Olaf Scholz natürlich. Nur Keir Starmer, der britische Premier, kam zu Fuß.
Die Botschaft des Vereinigten Königreichs liegt gleich neben dem
Amtssitz des französischen Präsidenten.
Schwarze
Limousinen, Händeschütteln, Schulterklopfen. Emmanuel Macron, der
Hausherr, eilt die Treppe hinunter. Die Szenen hat man oft gesehen, doch
der Anschein trügt. Nichts ist in Europa mehr Routine, seit Donald
Trump in der vergangenen Woche mit Wladimir Putin telefoniert hat. Und
seit die Europäer fürchten müssen, dass sich der amerikanische Präsident
mit dem Kriegsherrn im Kreml über ihre Köpfe hinweg auf einen Deal
verständigt, der vielleicht aussieht wie ein Frieden, aber den Keim des
nächsten Krieges in sich trägt.
Das
Treffen, zu dem Macron kurzfristig nach Paris eingeladen
hatte, war deshalb ein Treffen in höchster Not. Ein Akt der europäischen
Selbstbehauptung: Seht her, es geht um unsere Zukunft! Wir sind da und
lassen uns nicht einfach zur Seite schieben! Auch wenn der amerikanische
Außenminister Marco Rubio am heutigen Dienstag im saudi-arabischen Riad
mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow spricht, ohne dass die
Ukraine oder die Europäische Union dabei sind.
Die Diskussion wäre kürzlich noch undenkbar gewesen
Doch
symbolische Gesten allein werden den Europäerinnen und Europäern nicht
mehr helfen. Von Trump düpiert und von Putin bedroht, stehen sie vor
einer dramatischen Frage: Wie können sie künftig Frieden und Sicherheit
in Europa garantieren? Die Frage betrifft zunächst die Zukunft der
Ukraine, doch längst geht es um mehr als nur um die Ukraine.
Mark
Rutte, der Nato-Generalsekretär, hatte die Europäer schon auf der
Münchner Sicherheitskonferenz aufgefordert, sich nicht darüber zu
beklagen, dass Trump sie übergeht. Stattdessen sollten sie sich mit
„konkreten Vorschlägen“ in die Debatte über europäische Sicherheit und
Garantien für die Ukraine einbringen. In Paris wurde deshalb über zwei
sehr konkrete Fragen gesprochen: Wie wollen die Europäer künftig
aufrüsten? Und sind sie gegebenenfalls bereit, eigene Soldaten
einzusetzen, um Russland abzuschrecken und einen möglichen
Waffenstillstand in der Ukraine zu sichern?
Noch
vor Kurzem wäre eine solche Diskussion in der Europäischen Union
unvorstellbar gewesen. Auch im deutschen Wahlkampf spielen diese Fragen,
wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. Olaf Scholz war in Paris
der Erste, der schon nach zwei Stunden wieder aufbrach. Zu Hause wartete
am Abend eine weitere TV-Debatte. Scharf reagierte er in Paris auf die
Frage nach einem möglichen Einsatz von Soldaten. Die Debatte sei „völlig
verfrüht“ und werde „zur falschen Zeit“ geführt: „Wir sind noch nicht
beim Frieden, sondern mitten in einem brutal von Russland vorgetragenen
Krieg.“ Erst einmal müssten Friedensgespräche überhaupt stattfinden, bei
denen auch die Ukraine mit am Tisch sitze.
Nichts ist mehr ausgeschlossen
Unterstützung
bekam Scholz von der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.
Auch sie sagte nach dem Treffen, bevor über einen möglichen Einsatz
von Soldaten entschieden werde, müssten „viele, viele andere Dinge“
geklärt werden. Allerdings schlossen weder Frederiksen noch Scholz die
Möglichkeit, dass es zu einem solchen Einsatz kommen könnte, aus. Nichts
ist mehr ausgeschlossen – auch das kennzeichnet den Ernst der Lage.
Entschlossener
äußerte sich der britische Premierminister Keir Starmer. Schon vor
Beginn des Treffens hatte er in einem Zeitungsartikel geschrieben,
Großbritannien sei bereit, eigene Truppen in die Ukraine zu schicken.
Ihm falle es nicht leicht, das zu sagen. Aber: „Jeder Beitrag zur
Sicherheit der Ukraine ist ein Beitrag zur Sicherheit unseres
Kontinents.“ Putin müsse abgeschreckt werden. Diese Position wiederholte
Starmer in Paris. Allerdings fügte er hinzu, eine Sicherheitsgarantie
für die Ukraine müsste auch von den USA gedeckt werden.
Viel Zeit werden Trump und Putin Europa nicht lassen
Deutlich
offener als in der Frage nach Soldaten zeigte sich Scholz bei der
Frage, wie Ausgaben für Verteidigung – der Sozialdemokrat vermeidet das
Wort Aufrüstung – in Europa künftig finanziert werden könnten. Die
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union müssten hierfür Schulden
aufnehmen können, ohne dass diese „von den Kriterien, die wir in der
Europäischen Union für staatliche Kreditfinanzierung haben“ blockiert
würden, sagte Scholz in Paris.
Ähnlich hatte sich zuvor bereits
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäußert.
Verteidigungsausgaben sollen demnach künftig außerhalb des
Stabilitätspakts verbucht werden. Gefragt, ob er auch für eine gemeinschaftliche Verschuldung der EU-Länder offen sei, antwortete
Scholz ausweichend: Es werde „viele Vorschläge“ und „Raum für
Diskussionen miteinander geben“. Auch hier: keine roten Linien, nichts
wird mehr ausgeschlossen.
In
Paris haben die Europäer versucht, sich aus der Schockstarre der
vergangenen Tage zu lösen. Entscheidungen wurden aber vorerst nicht
getroffen. Die Gespräche sollen bald fortgesetzt werden, auch mit den
anderen EU-Ländern. Viel Zeit, das ahnen die europäischen Spitzen, werden
Donald Trump und Wladimir Putin ihnen nicht lassen. Viel Zeit wird auch
der nächste Bundeskanzler nicht haben, um die Frage zu beantworten, die
im Wahlkampf noch verdrängt wird: Was uns der Frieden in Europa wert
ist.