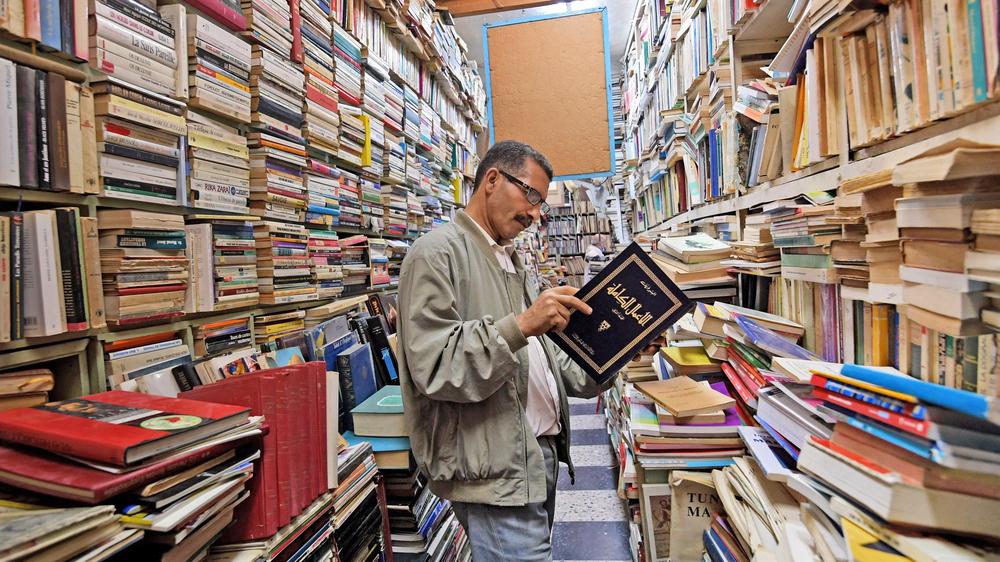ZEIT ONLINE: Herr Machcewicz, Sie kennen einen der Stichwahlkandidaten für die Präsidentschaft, Karol Nawrocki, recht gut. Sie waren Gründungsdirektor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Mithilfe der PiS ersetzte Nawrocki Sie 2017 an der Spitze des Museums. Wie lief das damals ab?
Paweł Machcewicz: Es war ziemlich dramatisch. Über ein Jahr lang wurde ich von der Regierung öffentlich schikaniert. Der Vorsitzende der PiS, Jarosław Kaczyński, gab ein Fernsehinterview, in dem er sagte, das Museum des Zweiten Weltkriegs sei kein polnisches, sondern ein deutsches Museum. Ein Geschenk Donald Tusks an Angela Merkel als Zeichen polnischer Unterwürfigkeit. Karol Nawrocki unterstützte diese Rhetorik. Die PiS wollte das Museum schließen, nachdem es mir gelungen war, es endlich zu öffnen. Es gab einen langen Rechtsstreit. Zwei Wochen nach der Eröffnung fällte das Oberste Verwaltungsgericht ein Urteil, das für mich eine politische Entscheidung war: der Kulturminister konnte das bestehende Museum auflösen. Am nächsten Tag gründete der Minister das neue Museum des Zweiten Weltkriegs. Kurz nach einer Pressekonferenz betrat Karol Nawrocki plötzlich mein Büro. Er kam in Begleitung eines Beamten des Kulturministeriums. Sie sagten, ich sei nicht mehr der Direktor, Nawrocki sei jetzt im Amt. Gleich am ersten Tag kündigte er an, die Ausstellung entsprechend der PiS-Kritik zu verändern.
ZEIT ONLINE: Wie haben Sie Nawrocki erlebt?
Machcewicz: Er
agierte von Anfang an als gehorsamer Soldat der Partei, ihr verdankt er
seine gesamte Karriere. Nawrocki ging gegen Elemente in der Ausstellung
vor, die er für nicht polnisch genug hielt und fügte Elemente hinzu,
die die Geschichtspolitik der PiS widerspiegelten. Beispielsweise eine
Installation, die suggerierte, dass fast alle Polen im Zweiten Weltkrieg
Juden gerettet hätten. Und er erklärte öffentlich, er sei stolz darauf,
60 Mitarbeiter des Museums entlassen und durch Menschen mit seinen
Ansichten ersetzt zu haben. Mit den Entlassungen verstieß er gegen Gesetze, das wurde von Arbeitsgerichten nachgewiesen.
ZEIT ONLINE: Nawrocki war früher Boxer und hatte angeblich Verbindungen zur Unterwelt. Ist das nicht ein etwas zu bunter Werdegang, um das höchste Staatsamt anzustreben?
Machcewicz: Nun, das sind keine Behauptungen, das ist belegt: Er
arbeitete in Nachtklubs, hatte Verbindungen zu Kriminellen, Neonazis und
Fußball-Hooligans. Gerade hat er zugegeben, bei verabredeten
Schlägereien dabei gewesen zu sein. So etwas ist illegal. Anonyme Quellen erklären, dass er Teil eines Zuhälternetzwerks gewesen sei, er habe Prostituierte zu Kunden gebracht. Die PR-Leute der PiS machen daraus das genaue Gegenteil von Trzaskowski, der ja jetzt sein Gegenkandidat der liberalen Bürgerkoalition ist. Nawrocki sei ein ehrlicher Kerl mit echtem Leben. Und Boxer würden nun mal nicht nur gegen Gentlemen kämpfen, sondern auch rauen Menschen begegnen.
ZEIT ONLINE: Im Wahlkampf wurde ihm mehr vorgeworfen, als nur zwielichtigen Typen begegnet zu sein.
Machcewicz: Zwei Wochen vor der Wahl kam noch etwas ans Licht. Nawrocki hat sich von einem Rentner in Danzig die Wohnung überschreiben lassen, wohl ohne Gegenleistung.
Das hätte sein politisches Todesurteil sein können: Ein
Präsidentschaftskandidat betrügt einen Rentner. Nur zeigte sich, dass
das die PiS-Wählerschaft gar nicht interessiert. Und die Partei stellte
die Geschichte als Operation dar, die von Donald Tusk mit einer
Spezialeinheit betrieben würde.
ZEIT ONLINE: Der Kandidat der liberalen Bürgerkoalition, Rafał Trzaskowski, hat die erste Runde der polnischen Präsidentschaftswahlen mit einem Vorsprung von weniger als zwei Prozentpunkten gewonnen. Wie blicken Sie auf den zweiten Wahlgang?
Paweł Machcewicz: Es scheint, als sei die politische Rechte in Meinungsumfragen leicht unterschätzt worden. Und Trzaskowski wurde leicht überschätzt. Die Unterschiede sind nicht groß, ein bis zwei Prozentpunkte. Das zeigt, wie gespalten die Gesellschaft ist: Wir haben eine eher liberale, proeuropäische Hälfte und eine populistische, nationalistische, antieuropäische oder mindestens euroskeptische Hälfte. Als 2023 die Regierung der PiS-Partei abgewählt wurde, gewann die Bürgerplattform unter Führung von Donald Tusk knapp. Jetzt haben Parteien rechts der Mitte wieder dazugewonnen.
ZEIT ONLINE: Rafał Trzaskowski machte Wahlkampf mit einer Art von Wirtschaftspatriotismus. Er lehnte EU-Handelsabkommen ab, kritisierte Deutschland, lobte polnische Äpfel. Das war überraschend viel nationalkonservative Rhetorik aus dem Mund eines liberalen Politikers. War das Strategie?