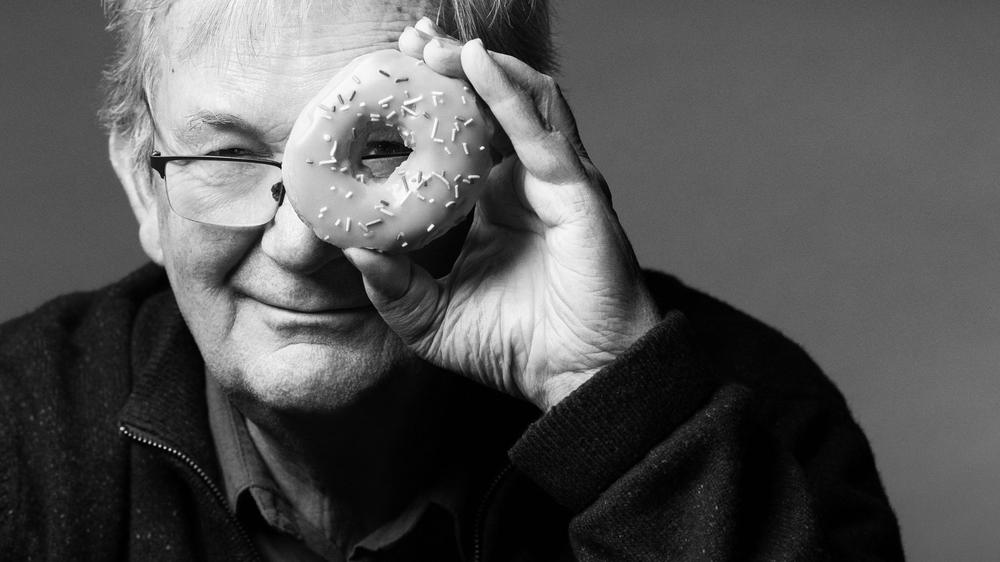Natürlich, die Eltern waren strikt dagegen. Rebecca, das schien abgemacht, würde Fabrikantin werden, die Textilfirma übernehmen, daheim im Odenwald. Und ja, sie hatte dann auch, ihnen zuliebe, einen Kurs im Maschinenstricken besucht. Nur dass dort irgendetwas mit den Lochkarten durcheinanderkam und das Gerät schließlich einen sehr seltsamen Pullover fabrizierte, einen mit drei Armen. Spätestens da war klar, sie würde Künstlerin werden, schon als Kind hatte sie davon geträumt.
Dann die Aufnahmeprüfung in Hamburg, Aktzeichnen, ein Wirklichkeitsschock: „Ich kam aus einem Internat, sehr behütet“, erzählte Rebecca Horn später in einem ZEIT-Interview. „Ich hatte noch nie eine alte Frau mit so grauer, faltiger Haut gesehen.“ Und erst die Füße: „Ganz verkrüppelt.“ Horn begann zu schwitzen, radierte, zeichnete, radierte, „bis da zum Schluss ein Loch war“. Eine verletzte, ruinierte Zeichnung – und für Rebecca Horn der Anfang von allem.
Man ließ sie zum Glück studieren, auf Probe zunächst. Und keine zehn Jahre später wurde Horn auf der Documenta in Kassel gezeigt, auch in Venedig auf der Biennale, und als erster Frau überhaupt widmete ihr das Guggenheim in New York eine Einzelausstellung. Mit Texten und Filmen, mit aberwitzigen Geräten, Tönen, surrealen Installationen aus Federn, Trichtern, Messern, Bettgestellen, einem Klavier, das kopfüber an der Decke hängt und sich abrupt und mit viel Getöse zu erbrechen scheint, weil alles sich öffnet, die Tasten liederlich hervorquellen – mit all diesen Werken und Taten, ihrem Ruhm, ihrer Freiheit schien sich Rebecca Horns Kindheitstraum zu erfüllen. Wäre da nicht die Sache mit dem dritten Bein gewesen.
Noch in Hamburg geschah es, während des Studiums, 1967, in der hohen Zeit der Entgrenzung. Weil sie eh schon immer über sich hinauswachsen wollte, experimentierte sie mit heißem Polyester und dachte daran, sich ein Extrabein zuzulegen oder einen Extrakopf, wer weiß. Was ihr niemand sagte: Wie giftig Plastikdämpfe sind. Beinahe wäre Rebecca Horn gestorben. „Fast zwei Jahre lang war ich vollkommen isoliert, lebte in einem Sanatorium und fühlte mich furchtbar allein.“ Einzig die Kunst war ihr geblieben, das Schreiben und Zeichnen, um „vom Bett aus die Isolation zu durchbrechen“.
Sie schien nun selbst „ganz verkrüppelt“, das Loch war in ihr. Und seither schwang es in ihrer Kunst nach: diese Geschichte eines beschädigten, leblosen Lebens – und wie es neu erwachte. Wobei es in ihrem Werk selten düster zuging oder abgründig wie etwa bei Bruce Nauman. Viel lieber versuchte sich Rebecca Horn im dadaistischen Spiel: Kehrt mal die Apparatehaftigkeit des eigenen Körpers hervor, dem lange Fühler wachsen, Stacheln, Hörner, auch Geweihe, manches erinnert an spätere Cyborg-Fantasien. Dann ist es umgekehrt, die Apparate menscheln, kratzen, fächern, klappern vor sich hin, einfach so, weil sie es können. Maschinen, die nichts produzieren, nicht einmal dreiarmige Pullover. Ein höherer Sinn ist da nicht auszumachen, keine Botschaft, die entschlüsselt werden will. Und das ist das Schöne am Hornschen Kosmos: Hier haben die Dinge ihre Bestimmung überwunden. Sind frei. Aber haltlos sind sie nicht.
Denn so sehr sich Rebecca Horn für das Bewegliche und Dynamische interessierte, blieben ihre Maschinen doch stets gezähmt, gefangen in ihrer Endlosschleife. Erst schlafen sie, sind still, wie tot. Dann: großes Erwachen, das Ruckeln beginnt, das Gleiten, Streichen, Stricheln. Um irgendwann wieder zu erstarren, ohne dass sich irgendetwas verändert hätte. Endloser Kreislauf, Bewegung um der Bewegung willen. Eine Poesie, die zurück an ihren Anfang will.
1990, als ihr Ruhm weiter anschwoll, zog sich Rebecca Horn in den Odenwald zurück. In der Fabrik ihrer Eltern errichtete sie ihr Atelier, „dort kann ich mich verkriechen vor der Welt“, erzählte sie. „Die Kraft, die ich brauche, erwächst aus einer selbst gewählten Isolation.“
„Eine neue Verbindung zum Himmel“
Unfassbar wollte sie bleiben, unnahbar, und obwohl ihr manche nun vorwarfen, ihr Werk sei über die Jahre immer esoterischer geworden, kitschiger auch, verstand sie sich stets als politischen Kopf. Als eine Künstlerin, die den Spuren der nationalsozialistischen Verbrechen nachging, etwa in Münster und in Buchenwald. Und die auch am Wettbewerb für das Holocaust-Mahnmal in Berlin teilnahm, wo sie einen großen Wald mit rotbelaubten Bäumen anlegen wollte, in der Mitte ein spiralförmiges Gebäude, das sich tief in den Boden bohrt. Ganz unten, in der Finsternis, hätte es einen Spiegel gegeben, er sollte Licht ins Dunkle holen. „Eine neue Verbindung zum Himmel“, darauf hoffte Rebecca Horn.
Seit einem Schlaganfall vor zehn Jahren saß sie im Rollstuhl, wieder schien sich ihr Körper gegen sie zu verschwören. Und wieder fand sie in der Kunst einen Ausweg, ein Mittel der Weitung und Belebung. Als „großes Glücksgefühl“, beschrieb sie die Arbeit. Und war sich gewiss: „Künstlerin werde ich bis zum letzten Atemzug sein.“
Wie nun bekannt wurde, ist Rebecca Horn am 6. September 2024 im Alter von 80 Jahren gestorben.