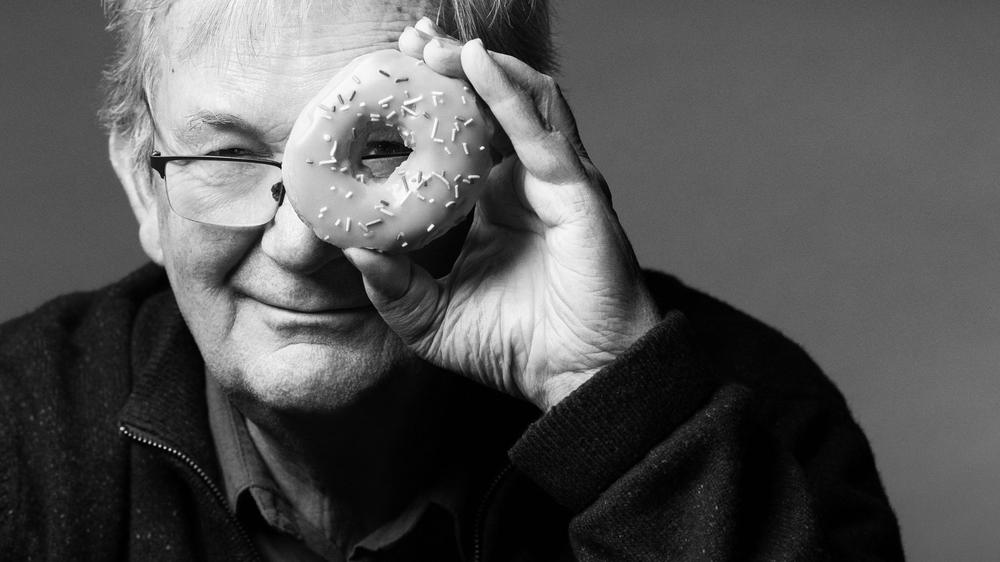Als im vergangenen Mai der legendäre Musiker und Produzent Steve Albini starb, war einer meiner ersten Gedanken: Tragisch, dass die Welt niemals ein von Albini aufgenommenes MJ-Lenderman-Album hören wird. Die Folk- und Rocksongs, die der junge Songwriter aus Asheville im US-Bundesstaat North Carolina schreibt, erscheinen wie gemacht für den trockenen Sound, den Albini in den Neunzigerjahren Bands und Künstlerinnen wie den Pixies, PJ Harvey und Nirvana verlieh. Auch zwei ebenfalls jung verstorbene Lieblingsmusiker von Lenderman arbeiteten einst mit Albini zusammen: Mark Linkous und Jason Molina, in Indiekreisen besser bekannt unter ihren jeweiligen Projektnamen Sparklehorse und Songs: Ohia. Hört man sich an, das zweite Studioalbum von Lenderman (zuvor waren auch zwei Homerecording-Platten erschienen), denkt man immer wieder: Was hätten all diese Männer nur für tolle Musik zusammen machen können.
Lenderman trägt seine Einflüsse offensiv vor sich her, sie reichen noch deutlich weiter zurück als bis in die Neunzigerjahre. Sein Song könnte ein vergessenes Stück aus Neil Youngs -Phase (1979) sein. In heult er wie ein Kojote und erinnert damit an den Songwriter Warren Zevon, der es in im Jahr 1978 ähnlich getan hatte. Den offenen Umgang mit solchen Vorbildern kann sich Lenderman leisten: Erstens gibt es für Rockmusiker wie ihn keine besseren. Zweitens braucht er sich mit seinen Songs gerade hinter niemandem zu verstecken.
Lenderman ist ein Anachronist, selbst den Albini-Sound hat sich der 25-jährige Künstler nur rückwirkend aneignen können. Allein ist er mit seinem Interesse an der Rock-’n‘-Roll-Vergangenheit allerdings nicht. Das traurige Untergenre der Rockmusik, das einst von Sparklehorse und Songs: Ohia mitgeprägt wurde und manchmal böswillig als Soundtrack weißer, männlicher Depression bezeichnet wird, hat gerade wieder Konjunktur. Sogar Musikerinnen entdecken seine einst geschlechtlich markierte Ästhetik für sich: So zählen neben Karly Hartzman, mit der Lenderman die Band Wednesday betreibt, auch Künstlerinnen wie Phoebe Bridgers, Adrianne Lenker mit ihrer Gruppe Big Thief oder Angel Olsen zur Speerspitze dieser neuen alten Traurigkeit.
Von diesen Weggefährtinnen unterscheidet sich Lenderman, weil er noch entschlossener in die Abgründe seiner Heimat blickt. Das Düstere ist für ihn wichtigstes Arbeitsmaterial, die Poesie des Hässlichen eine Kernkompetenz, wie der Filmemacher Zach Romeo in seiner Dokumentation über Lendermans Band Wednesday sagt. Auf findet er sie in den Landschaften seiner oft als Hillbillygegend verschrienen Heimat North Carolina, aber auch in den trashigen Ausprägungen jüngerer Popkultur. Einmal geht es bei ihm um Lightning McQueen, das Hauptauto aus dem Pixar-Film an anderer Stelle um Songs von Ozzy Osbourne, die er im Videospiel nachspielt.
Hatte Lenderman auf seinem 2022er-Album noch die Perspektive eines Outsiders eingenommen, kreisen viele seiner Beobachtungen diesmal um Konsummomente, die man eher als Zeichen einer bürgerlichen Midlife-Crisis verstehen würde. Im Song fordert er den Protagonisten sarkastisch dazu auf, seinen Trennungsschmerz in einem gemieteten Ferrari zu heilen und dabei den Blues des weißen Mannes zu hören: Mit Eric Clapton werde schon alles wieder gut. Später in entgegnet das lyrische Ich auf den Vorwurf, das eigene Leben zu verschwenden, dass er doch immerhin ein Strandhaus in Buffalo besitze – sowie eine Smartwatch mit Kompass und Handyfunktion. Auch hier, in prahlerischen Produktpräsentationen, findet Lenderman die Poesie des Hässlichen.
Zu solchen Zeilen spielt Lenderman Folkrock und Countryballaden, die deutlich weniger trostlos klingen, als man es bei seinen Texten erwarten würde. ist verspielt und liebevoll arrangiert, mit Fiedeln, Klarinetten oder der Pedal-Steel-Gitarre seines Wednesday-Mitstreiters Xandy Chelmis und Background-Vocals von Karly Hartzman. Die enge Bindung an die Herkunftsszene bleibt wichtig für Lenderman, auch wenn er inzwischen bei einem der größten Indielabels der Welt unter Vertrag steht. Entstanden ist einmal mehr zu Hause in Asheville.
In der bereits erwähnten Doku von Zach Romeo äußert sich Lenderman auch zu seiner lokalen Verwurzelung: „Die Leute reden viel darüber, dass wir aus dem Süden kommen“, sagt er dort. „Sie sind es eigentlich gewohnt, dass Bands aus größeren Städten als Asheville stammen. Ich denke aber gar nicht darüber nach, was für ein Ruf uns vorauseilen könnte.“ Auch diese Lakonie hätte ihm vermutlich Sympathien bei Steve Albini eingebracht, der für seine No-Bullshit-Haltung ebenso verehrt wie gefürchtet wurde. Wie gesagt: Hätte gut gepasst. Wäre aber vielleicht auch zu perfekt gewesen für Lenderman und seine Poesie des Hässlichen.