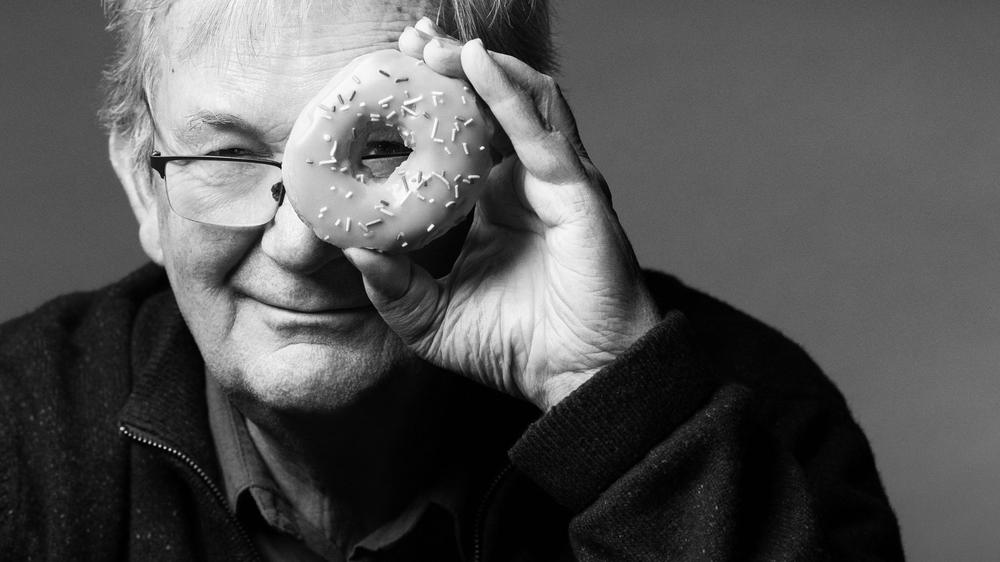Wer schafft es, betrunken Klassiker der deutschen Literatur zusammenzufassen? Was klingt wie ein Partyspiel für Germanistikstudenten, hat die 28-jährige Teresa Reichl zum Konzept ihrer YouTube-Show gemacht. In der Pandemie hat sie begonnen, dem „lieben Internetz“ mit breitem bayerischem Akzent Klassiker wie Goethes oder Schillers zu erklären. Das tut sie nun seit bald vier Jahren, inzwischen ist sie nicht mehr betrunken, dafür spricht sie noch schneller. Und aus ihrer Onlinesendung hat sie nun ein Buch gemacht, das genauso heißt wie ihre Videoreihe:
Classy, das meine sie durchaus im doppelten Sinne, erklärt Reichl am Telefon, „es geht natürlich um Klassiker, aber ich wollte das halt auch cool machen“. Reichl fand alte Texte schon als Schülerin spannend. Aber: „Mich hat immer gestört, wie über Literatur-Klassiker geredet wird. Nämlich so, dass ich mir als bayerisches Dorfkind dämlich vorkam.“ Deshalb redet Reichl anders – und hofft, dadurch Schülerinnen und Schüler mit ihrer Begeisterung anzustecken.
Im Buch erklärt sie Wesensmerkmale des Barock, der Aufklärung, des Sturm und Drang, der Klassik und der Romantik. Sie wirft Spotlights auf 15 Beispielwerke, jeweils drei aus jeder Epoche. Sie fasst die Handlung zusammen, weist auf Epochentypisches hin und gibt praktische Tipps für eine Text-Analyse und -Interpretation. So weit, so uncool.
Interessant wird es durchs Reichls Stil: Sie schreibt in flapsigem Plauderton, so wie sie in ihren YouTube-Videos spricht. Schiller und Goethe sind noch im Alter Findet Reichl etwas beeindruckend, sagt sie Im Sturm und Drang erzählt sie vom „U-30-Goethe“. Und der Kern der Klassik sei, immer Ruhe zu bewahren, auch wenn man „sich richtig mies den kleinen Zeh angehauen hat“. Sie habe sich nicht extra Mühe gegeben, besonders jugendlich zu klingen, sagt Reichl: „Das geht immer schief. Die Kids merken sofort, wenn man sich anbiedern will – und die hassen das.“
Worin Reichl, die auch Kabarettistin und Poetry-Slammerin ist, vor der Kamera brilliert, ist diese Ansprache: als wäre klassische Literatur eine Geschichte, die Freunde sich bei einem Bier erzählen, alle hören interessiert zu, ab und zu werfen sie „Was, echt?“ oder „So ein Schwein!“ ein. Gedruckt allerdings überzeugt das nicht: Banale Füllsätze ermüden („Also gut, lasst uns loslegen“); vorschnelle Relativierungen enttäuschen („Es macht Spaß! Also, find ich zumindest“); eifrige Vorankündigungen zerstören die Pointe („Jetzt wird’s richtig nerdig!“). Man hätte sich für das Buch ein durchgreifenderes Lektorat gewünscht.
Gelegentlich verliert man bei den Kurzzusammenfassungen auch den Überblick und wünscht sich mehr Einordnung. In Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens Schelmenroman verschlägt es den Helden vom elterlichem Gut über eine ärmliche Waldhütte nach Hanau, Moskau, Macau und Korea. Aber was ist Simplicius überhaupt für einer? Wieso muss er weg aus der Heimat? Dass Grimmelshausen mit seinem Abenteuerroman ein ganzes Genre erfunden hat, in der Zeit der großen Entdeckungsreisen von Europa in alle Welt, erfährt man leider nicht.
Am besten eignet sich – sowohl das Buch als auch die Videos – zur Stoffwiederholung. „Ich merke jedes Jahr zur Abizeit, dass meine Videos mehr Aufrufe bekommen“, sagt Reichl. Tummeln sich Gegenstand, Handlung und Figuren bereits irgendwo im Hinterkopf, geben ihnen Reichls Zusammenfassungen auf amüsante Art Kontur. Grimmelshausens „die nächste Reality-TV-Sendung“. Die drei Prologe, bevor Goethes wirklich anfängt: „Man gönnt sich ja sonst nichts“. Bettina von Arnims Briefroman „Sprachnachrichten, in denen man irgendwann vergessen hat, dass man aufnimmt“.
Unbedingt loben muss man Reichls Versuch, den Literaturkanon zu erweitern. Ihr Buch trägt den Untertitel und so stellt sie dem männlichen Kanon Werke von Autorinnen an die Seite. Neben von Arnims Briefroman etwa Sybilla Schwarz’ barockes Gedicht Sophie von La Roches Roman Christiane Karoline Schlegels bürgerliches Trauerspiel oder Luise Adelgunde Victorie Gottscheds klassisches Drama
Offensichtlichen oder unterschwelligen Sexismus von Autoren kreidet Reichl ergänzend an: Wieso zum Beispiel gehe es in Schillers Drama um zwei mächtige Frauen nur darum, „wer in wen verliebt ist, wer schöner ist und wer den Boy bekommt“? Und der Luise in Schillers möchte Reichl zurufen, dass es bei ihrem Geliebten Ferdinand, der sie aus Eifersucht umbringen wird, schon zu Anfang also Alarmsignale, gibt.
Als Poetry-Slammerin schreibt Reichl auch selbst, zum Beispiel ein Sonett im Stil von Andreas Gryphius’ Schmachtet bei dem barocken Dichter das lyrische Ich nach einer unwiderstehlich schönen, aber sonst wenig bemerkenswerten Frau, dreht Reichl den Spieß der Objektifizierung um: Ihr Text geht Und deshalb ist Teresa Reichls Stärke, sosehr sie sich selbst mit ihrem lockeren Ton, hohen Tempo und Wortwitz inszeniert, eine andere: Über den feministischen Ansatz schafft Reichl einen Einstieg in die Literatur, der sowohl die klassischen Werke als auch das junge Publikum ernst nimmt.