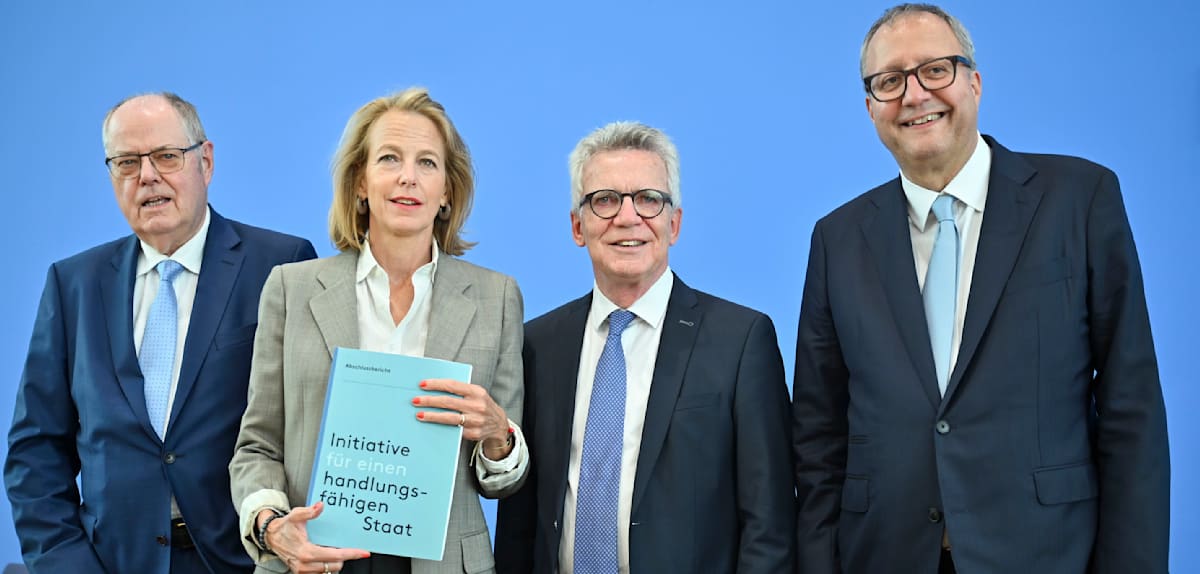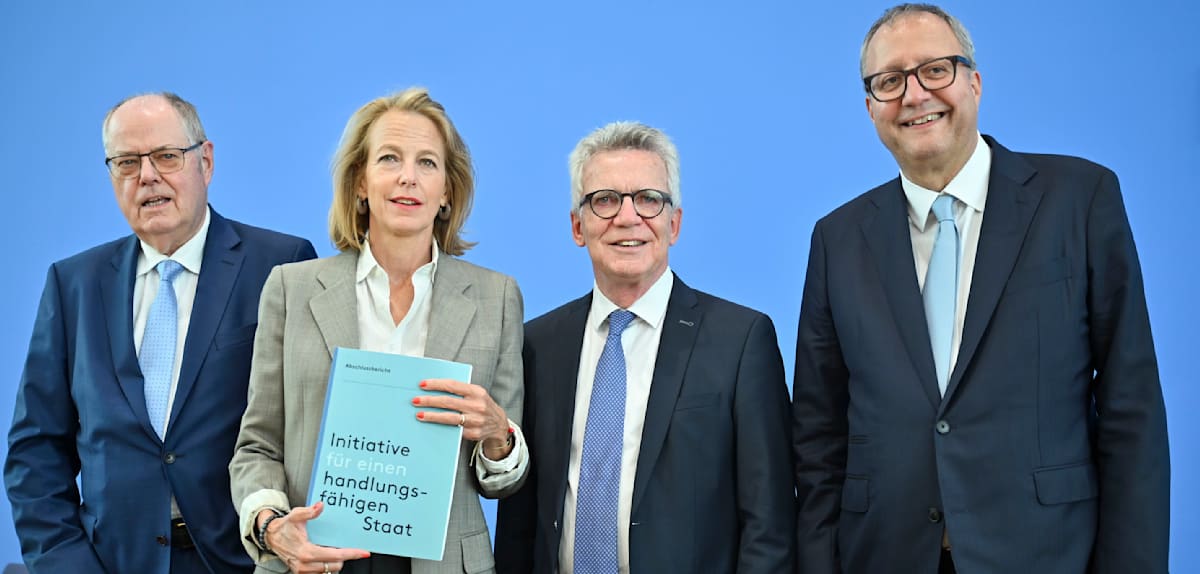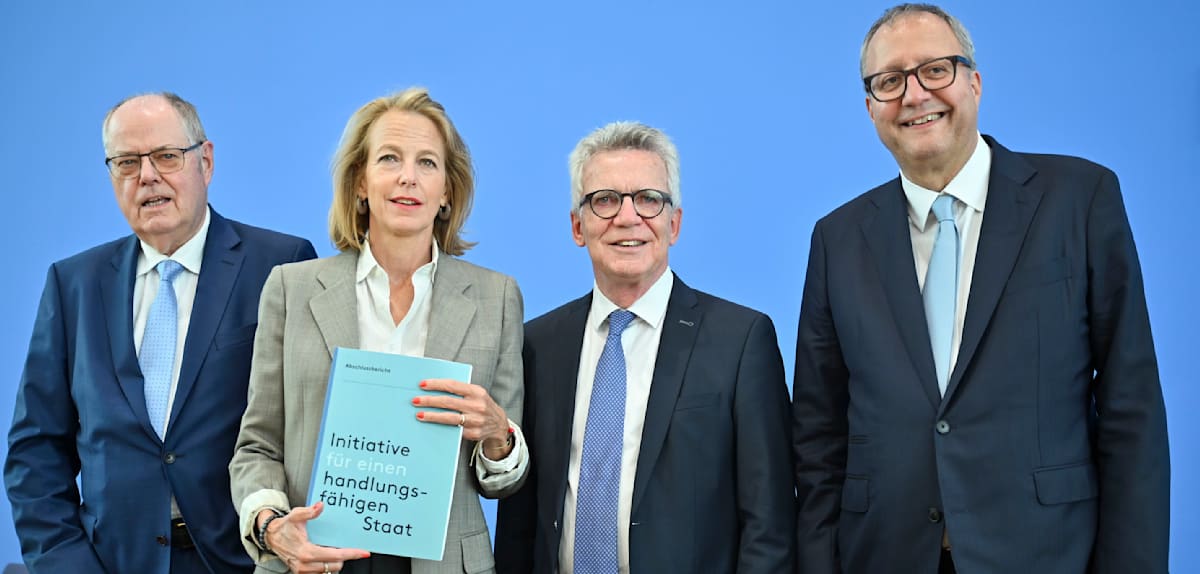Auf der Homepage der Stadt Frankfurt/Main liest man, dass die Paulskirche seit 1948 „ausschließlich als Ort der Erinnerung an den Beginn der deutschen Demokratie dient“. Inwieweit die Verleihung „Internationaler Hochhaus Preis“, die kürzlich zum elften Mal dort stattfand, die Demokratie fördert, erschließt sich zunächst nicht. Immerhin mutet die ritualisiert-feierliche Preisverleihung in der monumentalen Halle der ehemaligen Hauptkirche sakral an.
Mit 50.000 Euro, ausgelobt von der Stadt Frankfurt, Deka-Bank und Deutschem Architekturmuseum, soll das innovativste Hochhaus der Welt geehrt werden. Der Preis geht dieses Jahr an den dänischen Architekten Bjarke Ingels und den Italiener Carlo Ratti für ein gemeinsam geplantes Hochhaus mit dem Namen „CapitaSpring“ in Singapur.
Benannt ist der Wolkenkratzer, der mit seinen 280 Metern Höhe zum zweithöchsten Gebäude des Stadtstaates wurde, nach seinem Bauherrn, dem örtlichen Immobilienunternehmen CapitaLand. „Mit unserem Engagement für den Internationalen Hochhaus Preis möchten wir den Fokus auf zukunftsweisendes, nachhaltiges und wirtschaftliches Bauen richten“, sagt Dr. Matthias Danne, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deka-Bank.
Doch im 20. Jahr des Wettbewerbs, der bisher stets für den Hochhausbau richtungsweisende Projekte prämierte, enttäuscht die Entscheidung der Jury. CapitaSpring erfüllt kaum eines der vorgegebenen Kriterien. Weder die Nachhaltigkeit noch die Wirtschaftlichkeit und auch nicht der soziale Aspekt scheinen bei der Planung des 1,2 Milliarden Euro teuren Firmengebäudes von besonderer Relevanz gewesen zu sein. Weder wurde ressourcenschonend im Bestand gebaut noch bei der Materialwahl auf nachwachsende Rohstoffe wie Holz oder andere natürliche Materialien gesetzt.
Fragwürdig ist die Entscheidung auch deshalb, weil es auf der Veranstaltung nicht zuletzt um die Suche nach Vorbildern für den deutschen Immobilienmarkt geht. Wenn mehr in die Höhe gebaut werden soll, was manche als Ausweg aus der Wohnungsbaukrise propagieren – wie genau kann das ressourcenschonend und sozial verträglich gelingen?
Begrünung der Wolkenkratzer in Singapur inzwischen Standard
Wer schon einmal im boomenden Singapur war, weiß, dass dort andere Maßstäbe gelten als im krisengeschüttelten Europa. In dem asiatischen Stadtstaat, dem fünftreichsten Land der Welt, schießen die Hochhäuser nur so aus dem Boden. Sie dienen allerdings mehr den Ansprüchen an die Ästhetik und der Imagepflege ihrer Bauherren. Soziale Faktoren spielen beim Höher, Größer und Exzentrischer der Pläne hingegen eher eine untergeordnete Rolle. Das ist in Singapur wie auch in vielen aufstrebenden asiatischen Staaten schon lange Normalität. Immerhin ist mittlerweile aber eine Begrünung der Gebäude Standard.
Das Besondere beim CapitaSpring: Das Gebäude hat eine 35 Meter hohe Aussparung zwischen den Geschossen, in der 80.000 Pflanzen wachsen. Diese „Grüne Oase“, wie es auf der Website des Gebäudes heißt, soll dem futuristisch-kühlen Gebäude nicht nur etwas Leben verleihen, sondern auch eine „neue Verbindung zur Natur“ bieten. Doch die gewachsene echte Natur, in Singapur zunehmend bedroht durch fortschreitende Zersiedelung und künstliche Landgewinnung durch Landaufschüttung, enttarnt die dekorative Grünbepflanzung als Greenwashing.
Vielleicht spielte für die Entscheidung der Frankfurter Jury für das Hochhaus in Singapur aber auch ein anderer als der architektonische Aspekt eine Rolle. So ist der finanzstarke Bauherr CapitaLand seit 2018 auch in der hessischen Metropole engagiert. Damals kaufte er mit seinem Investmentfonds für 356 Millionen Euro das Hochhaus Gallileo an der Gallusanlage im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das 2003 fertiggestellte Gebäude, aus dem Anfang des Jahres die Commerzbank als Mieter ausgezogen ist, wird gerade umfänglich saniert. Ein neuer finanzstarker Investor könnte dem stagnierenden Hochhausmarkt der Stadt guttun. Erst kürzlich wurden hier einige Neubauvorhaben gestoppt.
Es gibt aber auch Beispiele, wie es besser geht. Nicht der Selbstdarstellung von Bauherren oder Architekten, sondern der verbrieften Zufriedenheit seiner Nutzer und der örtlichen Architektursprache dient hingegen das „Valley“ in Amsterdam, entworfen vom Rotterdamer Architekturbüro MVRDV. Im Frankfurter Wettbewerb zwar nur Finalist, wäre es ein würdiger Preisträger gewesen.
Das steinerne, 75.000 Quadratmeter Geschossfläche große Konglomerat aus drei miteinander über Treppen und Terrassen verbundenen verspiegelten Hochhäusern ist eines der interessantesten Neubauprojekte der vergangenen fünf Jahre in Europa. Den Architekten gelingt es, die schwierige städtebauliche Aufgabe zu lösen, dem gesichtslosen und nach Feierabend toten Bürostadtteil Zuidas im Süden von Amsterdam neues Leben einzuhauchen.
Die Türme sind je 67, 81 und 100 Meter hoch. Mit ihren freitragenden Apartments, den öffentlich zugängigen Terrassen mit spektakulären Ausblicken in eine künstliche Felslandschaft, die Wasserflächen, das Auf und Ab der ebenfalls öffentlichen „Wanderwege“ durch das Gebirge muss das Wohnen und Arbeiten im „Valley“ ein Erlebnis sein. Eine Erfahrung, die sicherlich noch intensiver wird, wenn das höchste Gebirge der Niederlande vollständig begrünt sein wird.
Nicht zuletzt, weil Projekte wie das „Valley“ Ausnahmeerscheinungen sind, stellt sich die Frage: Ist das Hochhaus, der teuerste und am wenigsten nachhaltige Bautyp, in Zeiten von Rezession und Klimawandel überhaupt noch zeitgemäß? Ja, glaubt der Direktor des DAM, Peter Cachola Schmal. Allerdings weniger in Europa, wo es aufgrund seiner alternden und schrumpfenden Bevölkerung langfristig keinen Bedarf mehr für das Bauen in die Höhe geben könnte. Doch in den wachsenden Millionenstädten Asiens und Südamerikas seien vor allem Wohnhochhäuser kein Luxus, sondern schlicht eine Notwendigkeit.
Anders könne die kostbare Ressource Land in den dicht bebauten Städten nicht effizient genutzt werden. Eine große Zukunft für Wolkenkratzer sieht er etwa auf dem afrikanischen Kontinent. Ob begrünt oder nicht, bleibt erst einmal unklar. Aber der Architekturexperte ist sich sicher: „Die afrikanischen Großstädte werden in einigen Jahren aussehen wie chinesische Millionenstädte. Dann werden die Hochhäuser in Afrika von den Chinesen gebaut.“