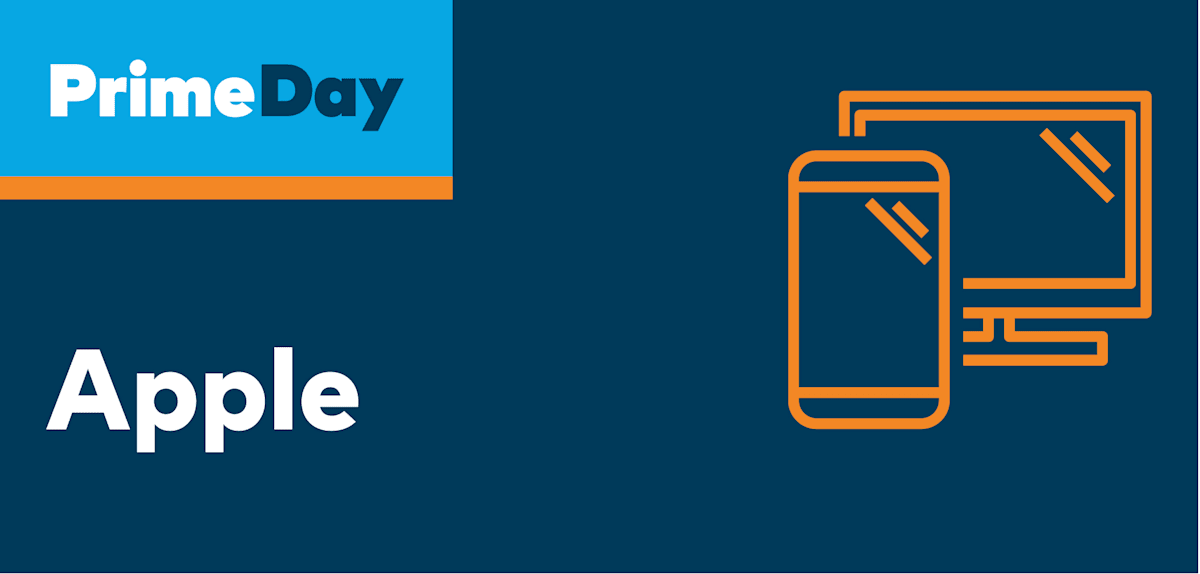Eigentlich hätte es der Wohlfühl-Termin der Reise von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) durch den Nordwesten Deutschlands werden sollen: Zwischen dem Besuch der energiepreisgeplagten Stahlfabrik in Georgsmarienhütte und einer Visite des gerade in der Absatzkrise steckenden VW-Werks in Emden schaute Habeck am Donnerstagnachmittag in Papenburg bei der erst kürzlich vom Staat geretteten Meyer Werft vorbei.
Zusammen mit dem Land Niedersachsen hat der Bund 80 Prozent der Werft übernommen und damit zumindest den Großteil der Jobs in Papenburg erhalten. Im Gegenzug hat Deutschland nun quasi eine staatliche Kreuzfahrtschiffproduktion. Der Auftritt bei der Betriebsversammlung in der Halle vor einem der Ozeanriesen und hunderten erleichterten Mitarbeitern hätte eigentlich ein Spaziergang für Habeck sein sollen.
Und tatsächlich beginnt der Minister damit, die Werft-Arbeiter zu umgarnen: Er ahne, wie schwer die letzten Wochen gewesen sein müssen, er komme ja selbst von der Küste; sie würden hier „fantastische Schiffe“ konstruieren, „wirklich stolze Bauwerke“. „Ich denke immer, ein Wunder, dass die Dinger schwimmen können“, sagt Habeck. Und dann komme da asiatische Konkurrenz, die mit unlauteren Mitteln arbeite, plus eine Pandemie, und dann reiche es eben plötzlich nicht mehr, seinen Job gutzumachen.
Natürlich könne man sagen: „Unternehmen, die am Markt ein Problem haben, ja, die sind vielleicht irgendwie nicht mehr gut aufgestellt und entweder stellen sie sich besser auf oder sie gehen weg“, sagt Habeck. „Aber so funktioniert die Wirklichkeit nicht und so funktioniert Wirtschaft und auch Wirtschaftspolitik nicht, weil Dinge von außen passieren, für die niemand etwas kann.“ Politik müsse dann ihre „Schutzfunktion ausüben, die wir uns gegenseitig schulden“, findet der Minister. Man müsse trotzdem darauf achten, dass sich die Rettung rentiere. „Wir können natürlich nicht als Staat jedes Unternehmen retten“, so Habeck.
Aber bei der Meyer Werft sehe man genau wie bei anderen Unternehmen, dass es nicht an der „Schwäche der Substanz“ liege, sondern die Unternehmen „kerngesund“ seien. Dann müsse man eben eine gewisse Zeit überbrücken. „Dann muss Politik auch bereit sein, zu helfen und sich nicht ideologisch zu verbeißen“, so Habeck. „Aber das steht natürlich nicht im Lehrbuch für Wirtschaftspolitik, dass der Staat Unternehmen übernehmen soll.“
Lehrbücher würden nun mal gar nichts nützen, „wenn die Wirklichkeit voll zuschlägt“.
Bei den Betroffenen in der Werft-Halle kommt das natürlich gut an, schließlich sind es ihre Jobs, die gerettet werden. Er sei dankbar, dass die Arbeiter alle trotz der Unsicherheit noch da seien. Im Kreuzfahrtschiffbau sei Deutschland mit seinen Werften noch Weltmarktführer, behauptet Habeck. „Also einer der wenigen Bereiche, wo wir nicht von der asiatischen Konkurrenz abgehängt wurden.“
Erst gibt es Applaus – aber dann kommt die Fragerunde
Aus den Schiffsbauern würden künftig auch Hersteller von Konverterplattformen, also von riesigen Umspannwerken, die vor der Küste für die Anbindung von Windparks ans Netz gebraucht werden. „Auf einmal haben die Werften eine ganz neue strategische Bedeutung, weil diese großen Umspannwerke auf See jetzt schon eine Mangelware sind“, sagt Habeck. „Und ehrlicherweise wollen wir nicht, dass sie aus China gebaut werden, das sind die Herzschlagadern unserer Energiewende.“ Das müsse schon „Made in Europe oder Made in Germany“ sein.
Klar gibt es dafür in Papenburg Applaus. Doch dann kommt die Fragerunde, und aus dem Spaziergang für den Minister wird eine fünfminütige Abrechnung mit der Politik der Grünen und des Wirtschaftsministers im Besonderen. „Moin, Herr Habeck“, setzt der Mitarbeiter an. Er wolle jetzt keine politische Diskussion starten, obwohl es „genügend Argumente gegen die Grünen-Strategie gäbe: Atomausstieg, E-Mobilität trotz nicht ausreichender Ladesäulen“.
Dann berichtet er von der neuen großen Solaranlage der Werft, die in den ersten Wochen schon sechsmal zwangsabgeschaltet worden sei, damit das Netz nicht überlastet wird – obwohl die Werft den Strom selbst habe nutzen wollte. Stattdessen habe das Unternehmen teuren Strom zukaufen müssen. „Dieses Problem zeigt deutlich, wie wichtig es ist, nicht nur in erneuerbare Energien zu investieren, sondern auch in die Infrastruktur, die deren Nutzung ermöglicht“, sagt der Mitarbeiter. „Warum werden selbst die, die den produzierten Strom zu hundert Prozent selbst nutzen wollen, vom Netz genommen?“
„Wir hoffen, dass Sie sich diese Worte zu Herzen nehmen“
Man wolle auch mit einer Windkraftanlage Strom erzeugen, doch der Bau des Windrads werde derzeit wegen angeblicher Lärmemissionen verweigert, weil der Betriebskindergarten im Weg steht. Der Produktionslärm der Werft selbst sei im Gegensatz zum Windrad hingegen kein Problem für den Kindergarten.
Dann macht der Arbeiter seinem Ärger über das Lieferkettensorgfaltsgesetz Luft. Der zusätzliche Aufwand werde wohl dazu führen, dass künftig Zulieferarbeiten in Regionen außerhalb der EU verlegt werden müssten. Habeck wird auf der Bühne langsam unruhig.
„Und als Letztes erlaube ich mir doch noch einen Hinweis an Ihre grüne Politik“, sagt der Mann. Vieles ergebe durchaus Sinn. „Aber auch diese Hauruck-Aktionen, die Ideologie der Grünen in kürzester Zeit umzusetzen, schadet uns allen“, sagt er. „Deutschland war wirtschaftlich und finanziell vor der letzten Bundestagswahl, als die Grünen nicht mit an der Spitze waren, in allen Rankings ganz oben, jetzt sind wir weit unten.“ Die Regierung habe den Eid geschworen, Deutschland zu schützen „und nicht in eine Wirtschaftskrise zu treiben, wo wir gerade mittendrin stecken“, sagt der Werft-Arbeiter. Viele könnten ihre Energierechnungen und ihren Lebensunterhalt nicht mehr bezahlen. „Manchmal muss man halt die eigenen Ideologien – die nicht unbedingt alle falsch sind – hinten anstellen, wenn es darum geht, die Wirtschaft voranzutreiben“, sagt er. „Danke fürs Zuhören und wir hoffen, dass Sie sich diese Worte zu Herzen nehmen.“
Man merkt Habeck auf der Bühne an, dass es in ihm brodelt. So will er das Ganze nicht auf sich sitzen lassen. Und so wird der Auftritt bei der Betriebsversammlung zu einer Art Generalprobe für den anstehenden Wahlkampf des wahrscheinlichen grünen Kanzlerkandidaten. Habeck antwortet energisch; jetzt ist er nicht mehr der Erklär-Onkel auf der Bühne, aber zumindest am Anfang ist seine Argumentation erstaunlich defensiv: Die Solaranlage sei offenbar nicht so gebaut worden, dass der Strom nur in der Werft verbraucht werden könne, sondern sei eben auch ans Netz angeschlossen. Zum Zustand dieses Netzes vor Ort könne er nun auch nichts sagen. Der Atomausstieg sei gar nicht von den Grünen beschlossen worden, sondern von einer schwarz-gelben Bundesregierung. „Also von wegen Ideologie“, sagt Habeck.
Ohne den Atomausstieg gäbe es auch keinen Bedarf für die Konverterplattformen, sagt der Minister. „Wenn also die Werftenstandorte jetzt eine neue wirtschaftliche Perspektive bekommen, dann ja, weil was Neues passiert“, so Habeck. Man könne unterschiedlicher Meinung sein zum Atomausstieg. „Aber was natürlich nicht geht, ist immer nur auszusteigen. Kohlekraftwerke aussteigen, Atomkraftwerk aussteigen und so weiter und so fort, und nichts aufzubauen.“ Jetzt würden durch die erneuerbaren Energien Arbeitsplätze geschaffen.
Dann wirkt Habeck kämpferisch
„Ja, Deutschland hat schwere wirtschaftliche Probleme in den letzten Jahren gehabt“, gibt Habeck zu. Das habe aber auch am Ukraine-Krieg gelegen. Obwohl Russland seine Gaslieferungen eingestellt hat, sei es nicht zum von Putin erhofften massiven Einbruch der deutschen Wirtschaft gekommen. „Ja, wir haben jetzt zwei Jahre lang kein Wachstum gehabt. Aber die Prognose war, wir gehen in die Knie“, sagt Habeck. Er wirkt nun kämpferisch. Die Vorgängerregierung müsse blind gewesen sein, nicht zu erkennen, dass man die Hälfte der eigenen Energieversorgung nicht von einem Land abhängig machen könne, das imperialistische Ansprüche habe.
Die Konsequenz seien hohe Energiepreise, hohe Inflation, steigende Zinsen gewesen. Unternehmen hätten deshalb nicht mehr investiert, aber das Schlimmste sei überstanden, Inflation und Zinsen sinken wieder, die Energiepreise seien auf dem Niveau von 2021. „Ja, das hat zweieinhalb Jahre gedauert“, sagt Habeck. „Aber es ist nicht die Ideologie der Grünen gewesen, die den Krieg angefangen hat, sondern es ist vielleicht die Blindheit der Vergangenheit gewesen, die uns so hart getroffen hat.“
Es sei viel zu lange nicht in Infrastruktur investiert worden, nun stehe man im harten geopolitischen Wettbewerb mit China und den USA und müsse trotzdem die Investitionen in Brücken und Stromnetze nachholen. Diese Kosten müsse man nun über längere Zeiträume strecken, weil Bürger und Unternehmen sie sonst gar nicht mehr stemmen könnten. „So ist mein Blick auf die Lage“, sagt Habeck. Er fragt, ob es weitere Fragen gebe. Es gibt keine mehr.