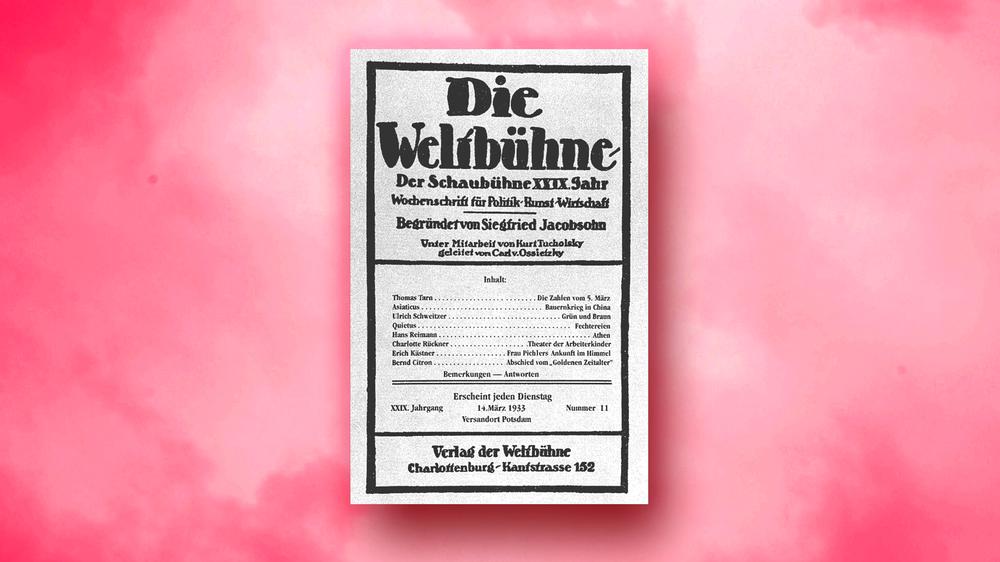In der vergangenen Woche erschien eine der berühmtesten
deutschen Zeitschriften plötzlich wieder, im altbekannten handlichen Format,
mit der altbekannten roten Farbe auf dem Cover, dem altbekannten Logo und dem
altbekannten Verweis „Gegründet von Siegfried Jacobsohn“: . Im
Jahr 1905 ist sie erstmals herausgekommen, damals noch unter dem ursprünglichen
Titel , 1918 wurde sie umbenannt. Das Wiederauftauchen der
, deren letzter Rest im Jahr 1993 nach eher linientreuen wie publizistisch
unbedeutenden Zeiten in der DDR unterging, hätte allein schon für Schlagzeilen
gereicht.
Denn in der Weimarer Republik war die wohl
wichtigste Zeitschrift des demokratischen Deutschlands, links-anarchisch, aber
auch bürgerlich und stets zum Widerspruch bereit. Kurt Tucholsky und Carl von
Ossietzky waren neben dem bereits 1926 gestorbenen Gründer Siegfried Jacobsohn
ihre bedeutendsten Lenker und Vordenker, die Autorenliste liest sich wie ein
intellektuelles Ehrenverzeichnis, Thomas und Heinrich Mann, Arnold Zweig, Else
Lasker-Schüler, Erich Kästner, Alfred Polgar.
Nur sorgte die erste Ausgabe der neuen jetzt
gleich für ganz andere Schlagzeilen, und das wegen eines Textes der
jüdisch-amerikanischen Bestsellerautorin Deborah Feldman. Der Titel ihres
Textes – „Die Deutsche Lebenslüge“ – verweist auf das Sachbuch (2024) von Philipp Peyman Engel, dem Chefredakteur der
Wochenzeitung . In ihrem Beitrag setzt Feldman Engels
jüdische Biografie in Beziehung mit der des Publizisten Fabian Wolff. Letzterer
hatte sich lange Zeit auch aus – vermeintlich – jüdischer Perspektive zu Themen
geäußert. Dann aber legte Wolff in einem Beitrag bei ZEIT ONLINE im Jahr 2023
offen, dass er gar kein Jude ist. Engel hat daraufhin in einem scharfen Text
unter dem Titel „Der Kostümjude“ in der von zuvor bereits
großen Zweifeln „an Wolffs angeblicher jüdischer Biografie“ geschrieben. Zu
viel habe „konstruiert, nicht plausibel“ gewirkt.
Feldman behauptet in ihrem -Text nun, sie sei von
einem „Familienmitglied Engels“ kontaktiert worden, dieses habe ihr mitgeteilt,
„Philipps Kernfamilie sei innerhalb der Verwandtschaft immer als Angehörige der
Bahai-Gemeinde wahrgenommen worden“. Engels Familie stammt aus dem heutigen
Iran, dort wurde der Bahaismus im 19. Jahrhundert gegründet, und manche Juden
sind dieser Religion beigetreten, um der Verfolgung durch die
Regierung zu entgehen, was Feldman gar nicht bestreitet. Sie beharrt in ihrem
Text sogar darauf, dass „Philipps Judentum“ nicht „Gegenstand dieses Artikels“
sei. Doch lässt er sich so lesen und wurde auch so gelesen. Der Zentralrat der
Juden, der die herausgibt, reagierte umgehend und schrieb
in einer Pressemitteilung, Feldman ziehe Engels „jüdische Identität in Zweifel“
und erkannte darin eine „Kampagne“. (Feldman wollte sich auf Anfrage der ZEIT
nicht äußern.)
Und dies geschah nun ausgerechnet in einem Magazin, dessen
Gründer Siegfried Jacobsohn selbst Jude war. Dessen
Enkel Nicholas Jacobsohn meldet sich aus den USA nun zu
Wort. Es sei „schändlich“, sagt er gegenüber der ZEIT, dass Feldman als Plattform für einen Angriff auf Engel nutze. Doch Jacobsohn, der
58 Jahre alt ist und als Wertpapierhändler in der Nähe von Boston lebt, wehrt
sich mehr noch als gegen Feldmans Artikel – von dem er sagt, er habe ihn nicht
gelesen – gegen das Neuerscheinen der an sich.
Hier nun stellen sich einerseits juristische, andererseits
moralische Fragen, und die wichtigsten lauten: Wer darf, wer sollte fortführen, so man sich eine Wiederaufnahme dieses historisch
gewordenen Magazins wünscht?
Zur Beantwortung dieser Fragen ist ein Exkurs in die
Historie der Zeitschrift sowie ins deutsche Markenrecht nötig. Um eine Marke, wie die der wiederzubeleben, benötigt man ein entsprechendes Recht.
32 Jahre lang, bis zur Neuauflage jetzt, ist unter dem Namen kein
Magazin mehr unter einer entsprechenden Marke erschienen. Damals, also im
Jahr 1993, endete ein Rechtsstreit zwischen Peter Jacobsohn, Sohn des Gründers
Siegfried und Vater von Nicholas, und dem damaligen Rechteinhaber Bernd
Lunkewitz um die Markenrechte der : Anders als zu DDR-Zeiten konnte
Peter Jacobsohn im wiedervereinigten Deutschland Zugriff auf die Marke
reklamieren und damit auf das familiäre Erbe. Ob juristisch zurecht, ist nie
abschließend geklärt worden, Lunkewitz willigte nach einem ersten Prozess (den
Jacobsohn verlor) in einen Vergleich ein und äußerte, dass er sich mit dem Erbe
des Verlagsgründers nicht streiten wolle.
Man konnte das als ein Einsehen verstehen, dass es moralisch
allerbeste Gründe gab und gibt, nicht gegen den expliziten Willen der
Gründerfamilie eine Zeitschrift unter dem alten Namen zu betreiben. Die Nazis
hatten bereits Anfang März 1933 verboten. Carl von Ossietzky war
damals am Tag nach dem Reichstagsbrand verhaftet worden, der noch minderjährige
Peter Jacobsohn musste mit seiner Mutter Edith, die den Weltbühne-Verlag nach
dem Tod ihres Mannes weitergeführt hatte, nach Wien fliehen. Später gelangten
Mutter und Sohn nach Zürich, schließlich nach London. Edith Jacobsohn starb
dort am Silvestertag 1935, auch sie war eine bedeutende Verlegerin, in ihrem
deutschen Kinderbuchverlag Williams & Co. erschien die von Jacobsohn selbst
unter ihrem Mädchennamen Schiffer übersetzte erste deutschsprachige Ausgabe von
. Zudem verlegte Edith Jacobsohn die ersten Kinderbücher von Erich Kästner, etwa und .
Vor ihrem Tod hat Edith Jacobson den Weltbühne-Verlag
verkauft. Ob das rechtmäßig geschah oder ihrem da noch nicht geschäftsfähigen
Sohn Peter qua Erbe eigentlich die Mehrheit der Verlagsanteile zustand, ist
eine offene Frage.
Peter Jacobsohn wurde nach Beginn des Zweiten Weltkriegs in
Großbritannien wegen seiner deutschen Herkunft nach dem sogenannten Defence
Regulation 18B interniert, das geschah auch mit von den Nazis verfolgten Juden und Jüdinnen, nicht gerade ein Ruhmesblatt in der Rechtsgeschichte des
Vereinigten Königsreichs. Jacobsohn war dann einer derjenigen Deutschen, die
1940 auf einem zum Truppentransporter umfunktionierten Kreuzfahrtschiff namens
nach Kanada deportiert werden sollten. Ein deutsches U-Boot
versenkte die dann aber vor der Küste Irlands, Hunderte Menschen
ertranken. Peter Jacobsohn war unter den
Überlebenden. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs emigrierte er in die USA,
Mitglieder der erweiterten Familie wurden im Holocaust ermordet.