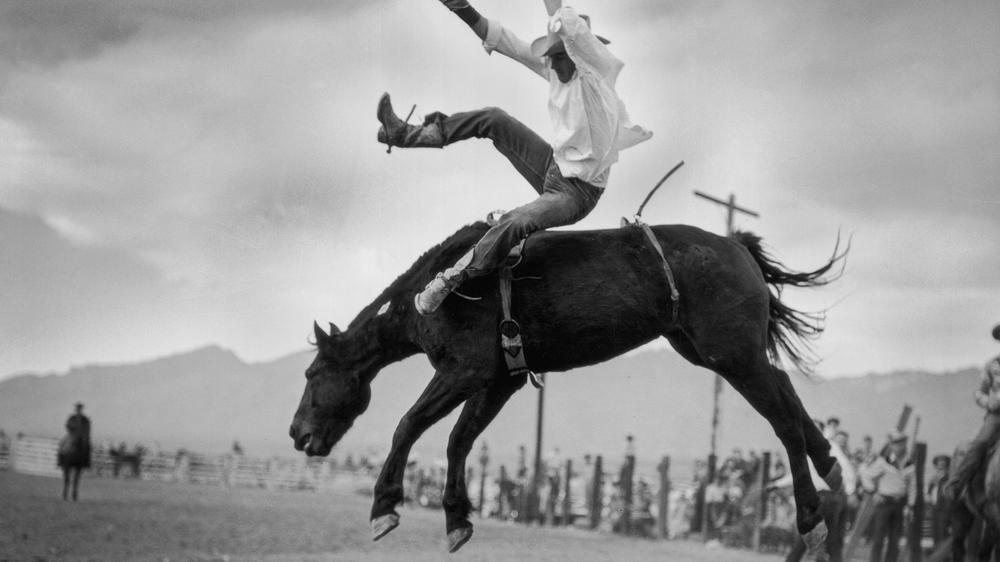Der Cowboy wurde schon oft missbraucht – als Zirkusnummer
und Zigarettenmann und natürlich als Zerrbild hölzerner Männlichkeit. Aber so
etwas wie derzeit ist selbst ihm noch selten widerfahren. Da heißt es, der
Wunsch von Donald Trump, sich Grönland einzuverleiben, sei Cowboy-Kolonialismus, seine Weltpolitik die eines Cowboy-Messias, der sich selbst für
den Guten halte und alle Probleme im Duell lösen wolle. Shootout statt Gespräch,
Kugeln statt Kompromiss und Kooperation. Das passende Buch dazu gibt es
natürlich längst: Aber jetzt mal im Ernst, Donald Trump soll ein Cowboy sein? Bei dieser Vorstellung müssten sogar dem Kostüm-Indigenen der Trump-unterwürfigen Village People die Tränen kommen.
Aber damit nicht genug. Natürlich war der Cowboyhut neben dem roten MAGA-Käppchen
die meistgesehene Kopfbedeckung von Trump-Fans im zurückliegenden Wahlkampf. Er lässt sich mühelos
als Symbol für US-amerikanischen Isolationismus und ein tief sitzendes
Misstrauen gegen den Staat deuten. Außerdem steht der
Cowboy in allen politischen Lagern für das Recht, eine Waffe zu tragen und zu
gebrauchen – und damit natürlich für das expansionistische Erbe der USA, die
diese ewige Suche nach neuem Land und neuer Macht, die sich
erfahrungsgemäß am leichtesten und blutigsten mit Waffengewalt erobern
lässt.
Gegen all das kann sich der wahre Cowboy nicht mehr wehren. Von ihm
ist nicht mehr übrig als sein Hut und seine Stiefel – und, na gut, ein Platz
im Wörterbuch. Und einer auf Netflix. Der Rest ist Staub und Geschichte.
Es muss sich deshalb jemand aufraffen, ihn zu
verteidigen. So viel politisch-kulturelle Aneignung, wie ihm widerfährt, hat er einfach
nicht verdient. Zumal der historische Cowboy, vorurteilsfrei betrachtet, ein
echtes sein könnte. Der Cowboy schonte Ressourcen, bewegte sich ohne
fossile Energie fort und versiegelte kein Land, um etwas darauf zu errichten. Er
war ein Hirte, sorgte für sein Pferd und respektierte es, vermutlich liebte er
es sogar auf eine emotional reduzierte Weise. Kurzum, der Cowboy lebte in Einklang mit der
Natur, soweit das für einen modernen Menschen möglich ist. Sogar seine Kleidung
bestand aus nachwachsenden Rohstoffen. Über das Leder müssten die Veganer und
Vegetarier in diesem Moment bitte hinwegsehen, dafür gibt es heute die
entsprechenden Ersatzstoffe.
Aber zurück zum Cowboy, dem Minimalisten, dem
ressourcenschonenden Naturliebhaber, dem freiheitsliebenden, seine Ansichten
meistens für sich behaltenden, ungewaschenen Trockenshampoo
gab es halt noch nicht. Das Cowboyleben hätte es in jedem Fall verdient, im
jüngsten Buch von Luisa Neubauer – – als
nachhaltiger Lebensstil gepriesen zu werden.
Diese eben geschilderten Wesensmerkmale werden inzwischen auch
in Hollywood wahrgenommen, an jenem Ort, der wohl am meisten dazu beigetragen
hat, den Rinderhirten in einen Mythos zu verwandeln. Niemand, der an
die Kraft von Filmen glaubt, historische Realität für die Gegenwart auszudeuten,
kann sich darüber wundern. Infolgedessen verteidigen die Cowboys in der Fernsehserie
nun also in der fünften Staffel die von ihnen eingezäunte,
dann aber überwiegend sich selbst überlassene Weite von Montana gegen das
Finanzkapital und gegen einen industriellen Raubbau, der Natur in Entertainment-Parks
verwandeln will, der Berge mit Skipisten und Täler mit Bungalows vollballern
möchte. Diese Cowboys mögen Republikaner sein, aber sicher nicht MAGA.
Okay, in gehen sie nicht
besonders zimperlich vor, sie morden, foltern auch ein bisschen, sie bedrohen
und prügeln sich so ungehemmt, wie andere Menschen zum Fitnessboxen gehen. Aber
das tun sie ja nur in diesem Ausmaß, weil sie so unter Druck gesetzt werden: Das Kapital lässt sie nicht in Ruhe. In mancher Rezension dieser Serie
konnte man Sätze lesen, die einer Täter-Opfer-Umkehr gleichkamen. All diesen
Fehl-Deutern sei entgegengeschleudert: Der Cowboy war fast immer ein Opfer der
Verhältnisse!
Wir müssen gar nicht weiter über Opferbereitschaft, Ausdauer
und Loyalität reden, die den Cowboy schon früher in Hollywood (und natürlich in
der historischen Realität) ausgezeichnet haben, müssen nicht an die graubraunen
Augen von Kevin Costner erinnern, an Hauptdarstellerinnen wie
Jennifer Jason Leigh in , Natalie Portman in und Sharon Stone in Ja, was ein Cowboy ist, hat sich längst von der Frage des
Geschlechts gelöst, und wer das mit der zunehmenden Diversität und
charakterlichen Komplexität in diesem Genre nicht wahrnehmen möchte, dem sei noch
der eigentliche Star in der Serie empfohlen: Kelly Reilly.
Im Angesicht der kulturellen Revolution von rechts, die in
den USA begonnen hat, wäre gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, dem Cowboy im US-amerikanischen
Nationalmuseum, dem National Museum of American History, wieder eine ständige
Ausstellungsfläche freizuräumen. Wieso führen die Kuratoren dazu nicht gleich
noch einen ein? Er könnte sich einreihen in den den und den
Das wäre ein geradezu genialer Schachzug, um der aktuellen Executive
Order von US-Präsident Donald Trump mit dem Titel „“ nur scheinbar entgegenzukommen und der MAGA-Bewegung den
Cowboy-Mythos dann zu entreißen. In so einer Ausstellung wäre genug Platz, um
auch an all das zu erinnern, was den historischen Cowboy durchaus zu einer
ambivalenten Berufsgruppe macht. Neben all seinen positiven Eigenschaften
(siehe oben) könnte auch die Verachtung und Gewalt gegenüber Indigenen ihren Platz
bekommen, seine gelegentliche Söldnermentalität, seine oft erbärmliche und aus heutiger
Sicht archaische Vorstellung von Beziehungen und Gesellschaft. So könnte das
Museum dem Cowboy das zurückgeben, was ihm durch seine Politisierung genommen
wurde: seine historische Gestalt. Und diese Ausstellung hätte noch einen
schönen Nebeneffekt. Statt rassistische Konföderierten-Generäle und -Politiker
wieder aus den Arsenalen zu holen, wie Donald Trump es möchte, könnte die
Museumsleitung nun sagen. „, wir brauchen den Platz für den
Cowboy.“