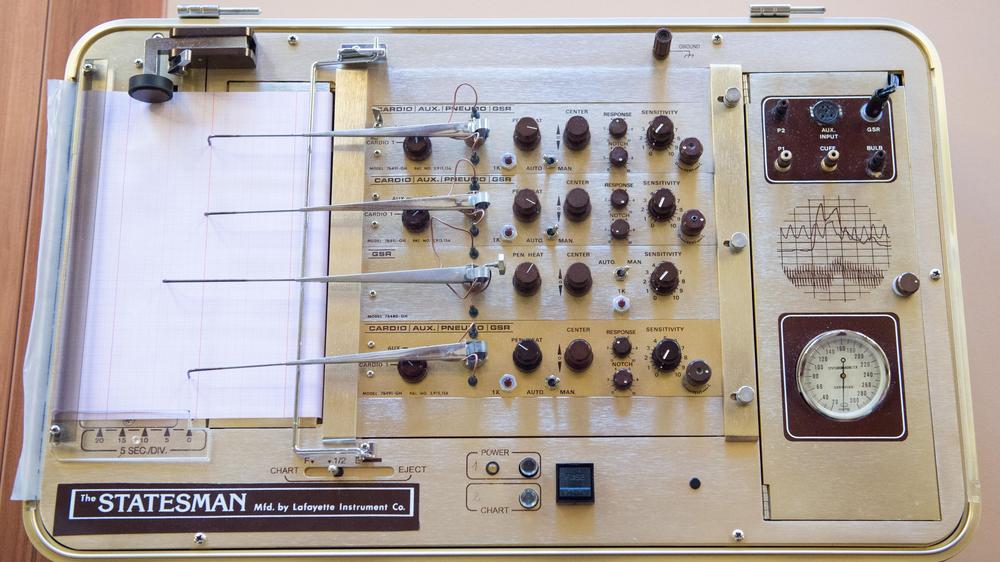Es
war einmal Herostrat. Er nahm eine Fackel und begann sein Werk: Seine Tat
zerstörte den größten Tempel der griechischen Welt, eines der sieben
Weltwunder, einen Spiegel technischen und künstlerischen Vermögens zu Ehren der
Göttin Artemis, der Zwillingsschwester des Apoll. Indem er den Tempel
anzündete, vernichtete er den Inbegriff menschlichen Könnens und menschlicher
Demut vor der Gottheit. Einfach so, weil er es wollte und weil er es konnte.
Niemand hielt ihn auf. Die Brandstiftung machte ihn bekannt. Unter Folter gab
er später die Beweggründe seiner Tat zu: Er strebe um jeden Preis nach Ruhm und
sehe keine andere Möglichkeit, diesen zu erlangen.
Herostrat
war eine namenlose Person ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, ohne Geschichte
und ohne Bedeutung. Seine Tat wie der verordnete Umgang damit, das Verbot,
seinen Namen in Geschichtsbüchern zu nennen, haben dennoch nicht seine
Bekanntheit und damit das Erreichen seines Ziels verhindert: Zerstörung dient
dem gewaltsamen Einprägen seiner Selbst in die Zeit, die dadurch zur eigenen
Gegenwart mit seinem Stempel wird.
Herostrats
Name steht seither für denjenigen, der aus Geltungssucht mutwillig zerstört.
Ein vergessener Name, zugegeben. Aber einer, der einen ganzen Typus
konstituiert hat, den es gilt, aus der Mottenkiste zu ziehen, um ihn
zeitdiagnostisch an das Gegenwartsgeschehen in den USA anzulegen. Wortfelder
der Zerstörung prägen seit Monaten die politische Sprache. Zunächst nach der
Wahl von Donald Trump in ängstlicher, aber noch ungläubiger Vorahnung, jetzt
seit Wochen in zunehmender Gewissheit. Das 80-jährige transatlantische Band
werde zerrissen, so geht die politische Sprache der vergangenen Wochen, aus der US-Staatsstruktur mit der Kettensäge ganze Bestandteile
eliminiert und die Budgets der forschungsstarken Universitäten gekürzt,
Vertrauen zerstört, die Hoffnungen der Menschen in der Ukraine zermürbt, die
Würde eines souveränen Staates untergraben werden.
Die
Liste ließe sich unendlich aus den täglichen Nachrichten fortsetzen und die
Welt steht überrascht, vollkommen entsetzt, in Teilen aber auch fasziniert vor
dem Auftauchen des Zerstörers auf der Bühne des Weltgeschehens. Aber warum? „Er
ist imstande, dem Leben jeden Augenblick anzusehen, dass es ’so nicht mehr weitergeht‘. […] Ihm kommt es nur auf die Gewissheit [an], dass er nicht einen
Augenblick ohne geschichtlichen Auftrag lebt.“ Das ist die Fähigkeit, die der
Philosoph Walter Benjamin in einem Fragment aus dem Jahr 1931 unter dem
Eindruck der politischen und wirtschaftlichen Krisensituation kurz vor der
Machtergreifung der Nationalsozialisten als „destruktiven Charakter“ bezeichnet
und somit zu einem, wenn auch wieder vergessenen Denkbild erhoben hat, übrigens
ohne direkten Bezug zum antiken Herostrat.
Aktuell
erscheint dieses Denkbild einen Ansatz zur Einordnung der
Grenzüberschreitungen und Brüche zu bieten, die wir täglich
erleben. Der Zerstörer hält sich für einen Berufenen, Auserwählten, der aus
Zeit Zeit zu machen versteht, indem er gewaltsam Hand an Bestehendes und
Kontinuitäten legt. „Einige überliefern die Dinge, indem sie sie unantastbar
machen und konservieren, andere die Situationen, indem sie sie handlich machen
und liquidieren. Diese nennt man die Destruktiven“, schreibt Benjamin. Der
destruktive Charakter ist immer frisch bei der Arbeit. Das macht ihn zum
Faszinosum. Als wäre er von eigentlich jugendlicher Natur, die ihm das
immense Tempo seines Wirkens vorschreibt, indirekt wenigstens: Denn jedes
Verharren ermöglicht Reflexion, ermöglicht ein Erkennen der Folgen des
Zerstörens und könnte so das Ende des Zerstörers bedeuten. Der Augenblick ist
das Zeitmaß des Zerstörers.
Vereinfachte Welt: Sie wird nur auf Zerstörungswürdigkeit geprüft
Würde Trump beispielsweise einen Waffenstillstand zwischen Russland und
der Ukraine erreichen, mit dem der Konflikt nur vorübergehend
eingefroren würde, aus dem aber kein Frieden entstünde – es widerspräche ganz und gar nicht dieser Logik des Augenblicks. Das Jetzt und nicht das Später. Der schnelle Cut
hier und dann auf zum nächsten, täglich neue Trümmer als Resultat. Die Frage,
ob die Geschwindigkeit beibehalten werde, beantwortete die Pressesprecherin des
Weißen Hauses daher dieser Tage mit:
Benjamin
verknüpft ein bestimmtes Handlungsmuster mit einem Zeitfaktor, einer
auffallenden Geschwindigkeit des Tuns, die überrascht, ja sogar überwältigt und
ablenkt. Und das mit unbändiger Freude. Lachend, fast ansteckend fröhlich,
überlegen grinsend, motiviert und glücklich mit dem vollbrachten Werk genauso
wie mit dem Entsetzen, das dieses beim Rest der Welt auslöst. Die beschwingten
riesigen Unterschriften mit dem Trump-Edding auf täglichen Dekreten, vergnüglich
erledigte Destruktionsnews mit Haken drunter in den sozialen Netzwerken, eine
ausgelassen-heitere Kabinettsrunde. Walter Benjamin konstatiert für den Prozess
des Zerstörens Spaß und Freude, denn er befreie von Ballast und reduziere auf
das Wesentliche: „Denn Zerstören verjüngt, es heitert auf, weil jedes
Wegschaffen dem Zerstörenden eine Aufklärung, eine vollkommene Reduktion, wenn
nicht Ratifizierung des eignen Zustands bedeutet. Zu solchem apollinischen
Zerstörerbilde führt erst recht die Einsicht, wie ungeheuer sich die Welt
vereinfacht, wenn sie auf ihre Zerstörungswürdigkeit geprüft wird.“