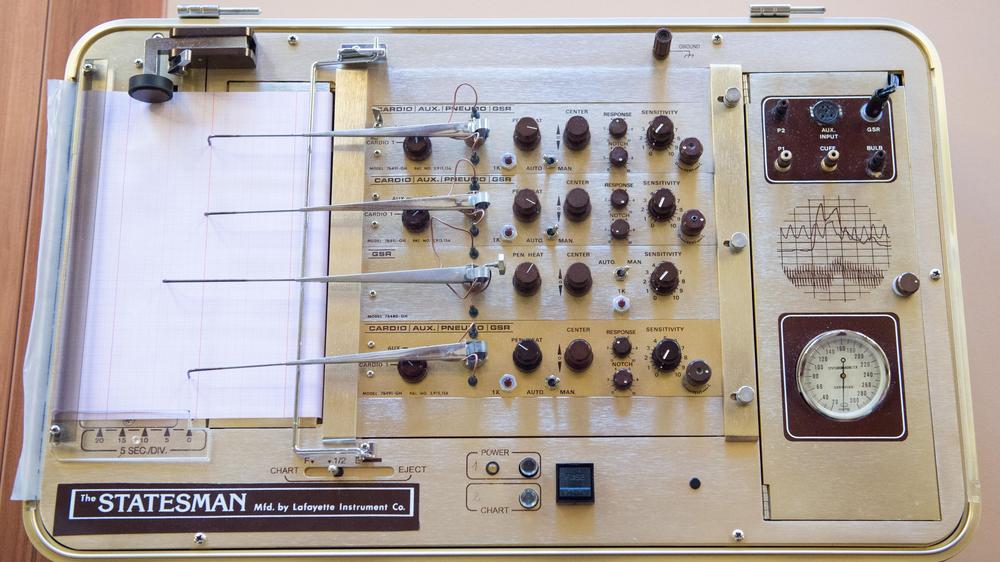Wäre die Bundestagswahl nicht am vergangenen
Sonntag gewesen, sondern an irgendeinem Sonntag im Januar, dann wären die
Osteuropäer skeptischer geblieben. Sie hätten nach Friedrich Merz‚ Verhältnis
zu Donald Tusk oder Kaja Kallas gefragt. Geprüft, ob der Bundeskanzler in spe
die baltischen Staaten bereist und deren Einstellung zu Russland wirklich
durchdrungen hat. Heute ist das alles anders, fast egal.
Dass die USA die Ukraine-Friedensgespräche über die
Köpfe der Europäer hinweg begonnen haben, macht die politische Lage zu ernst
für solche Befindlichkeiten. Natürlich gab es in den Achtzigerjahren ähnliche
Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland, aber Donald Trump und Wladimir
Putin sind nun mal nicht Ronald Reagan und Michail Gorbatschow.
Ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Merz,
gegenüber Deutschland aber bleibt, trotz aller Gefahr: Wie wird die
Sicherheitspolitik des neuen Bundeskanzlers wirklich aussehen? Olaf Scholz‘
hochtrabende Zeitenwendeerklärung, der, gelinde gesagt, keine entsprechende
Wende in der EU-Sicherheitspolitik folgte, hat man in Polen noch gut in
Erinnerung. Die Außenpolitik des scheidenden Kanzlers galt als eine von Zögern
und Verspätungen geprägte, nicht von Verlässlichkeit.
Doch der komplette Richtungswechsel in der
US-amerikanischen Außenpolitik sollte nun auch den Deutschen vor Augen führen,
was wir Osteuropäer schon lange begreifen mussten: Unsere kleinen liberalen
Demokratien sind nichts als geopolitische Enklaven zwischen den Weltreichen. Natürlich
fürchten Länder wie Polen, die deshalb in der Vergangenheit nicht nur einmal,
sondern mehrfach von der Landkarte gestrichen wurden, eine Wiederholung dieses
Schicksals. In den Hauptstädten von Staaten mit einem derart posttraumatischen
Souveränitätsverständnis lautet die wichtigste Frage deshalb, auf wen man sich
in dieser neuen Ordnung wirklich verlassen kann. Das sind existenzielle
Anforderungen an Friedrich Merz, die keinen Raum für Laxheit lassen.
Gleich nach der Bundestagswahl betonte Merz die
Notwendigkeit eines starken und einigen Europas. Eine kurze Bemerkung, die in
Ländern wie Polen und Litauen zwar ernst genommen wurde, aber in starkem
Kontrast steht zu dem, was in Deutschland wirklich passiert ist. Die Stärke der
AfD bei der Bundestagswahl hat noch einmal mehr deutlich gemacht, dass es nicht
nur ein Europa, sondern mindestens zwei Europas gibt. Es geht dabei nicht mehr um
die alte Spaltung zwischen einem postkommunistischen und einem westlichen
Europa.
Ein Europa ist das der nationalen Populisten. Ein
Europa der AfD, an das Elon Musk, J. D. Vance und Donald Trump appellieren. Ein
Europa, in dem die Rechtsaußen-Parteien in Österreich, Ungarn oder Frankreich zumindest
teilweise in politischer, personeller, ideologischer und finanzieller Hinsicht
unter dem Einfluss der zwei neuen Reiche, USA und Russland, stehen. Dass die
USA plötzlich Positionen verkünden, die denen Russlands verblüffend ähnlich
sind, markiert die existenzielle Bedrohung für die EU, die darin liegt: Es gibt
auch aus dem Westen keinen Schutz mehr.
Das andere Europa ist jenes, das sich auf Werte wie
Menschenrechte, liberale Demokratie und die Idee vom gerechten Frieden einigen
kann. Das ist unser Europa. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob
Deutschland unter Friedrich Merz bereit ist, eine Vertrauenskoalition mit den
Osteuropäern einzugehen. Ob das Land ihre Sorgen um Souveränität besser verstehen
möchte als Deutschland unter Scholz.
Diese Sorgen sind begründet, um das noch einmal zu betonen.
Wird Osteuropa wieder einmal um einen Platz am Tisch kämpfen müssen, wie 2014,
als Polen von den Ukraine-Gesprächen im Normandie-Format ausgeschlossen wurde? Warum
sollte sich der atomare Schutzschirm Merz zufolge auch auf Deutschland
erstrecken, aber an der Oder enden? Der Verlauf dieser Grenze lässt überall
in Osteuropa die Alarmglocken schrillen, weil er unweigerlich an die alte
Ostblockgrenze erinnert.
Vergleichbare Bedenken regen sich angesichts von
Vorschlägen wie jenem der CDU, die Schengen-Zone effektiv abzuschaffen, um
illegale Einwanderung zu verhindern. Leider besteht einer der ideologischen
Erfolge der Populisten darin, selbst da in der Sicherheitspolitik auf
nationalen Eigennutz zu setzen, wo man auf multilaterale Zusammenarbeit angewiesen
wäre. Und wer weiß, weiterhin die Führung in diesem Wettrennen um
nationalistische Erwartungen zu beanspruchen, könnte letztlich zum Ende einer
Kanzlerschaft Merz und einem Wahlsieg für die AfD führen, zur Rückkehr von
Deutschlands dunkelsten Geistern.
Seit Februar 2022 ist viel über die Verlagerung des
Schwerpunkts der EU nach Osten geschrieben worden. Doch das ist ein Irrtum.
Wenn sich das politische Gewicht damals wirklich auf einige ehemalige
postkommunistische Länder verschoben hat, dann nur, weil diese Länder bereit
waren, Verantwortung für die Außen-, Migrations- und Militärpolitik der EU zu
übernehmen.
In der Unterstützung der Ukraine sollte es vor
allem darum gehen, sich nicht vor der Verantwortung, den Opfern und den enormen
Kosten zu drücken. Die Bundestagswahl hat uns einmal mehr erinnert, dass diese
Bürde nicht von ganz Europa getragen wird, sondern nur von einem seiner Teile.
Nämlich jenem Teil, der im Licht der tragischen Geschichte des 20. Jahrhunderts
versteht, dass nationales Eigeninteresse nicht immer vor Solidarität stehen
kann.