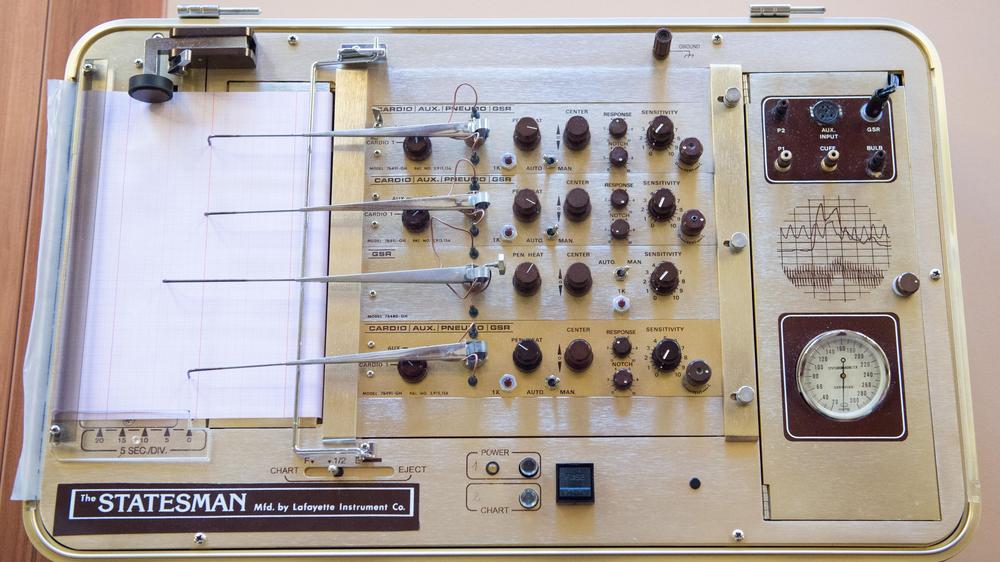Seitdem die neue US-Regierung klargemacht hat, dass sie der Ukraine im Krieg gegen Russland nicht weiter wie bisher helfen will, seitdem Donald Trump mit Wladimir Putin über die Zukunft der Ukraine über deren Köpfe hinweg verhandeln möchte, stellen sich eine Reihe von drängenden Fragen: Vor allem daran, wie es für die Ukraine weitergehen kann. Aber auch an die europäischen Verbündeten der Ukraine. Denen könnte eine Rolle zufallen, die sie keinesfalls haben wollen – und der sie unter aktuellen Umständen kaum gewachsen wären.
Drei Jahre ist der russische Einmarsch in wenigen Tagen her. Die Angreifer haben ihre
Invasionsziele zwar bis heute nicht erreicht, aber russische Einheiten halten einen
beachtlichen Teil
der Ukraine besetzt. Und nahezu jeden Tag erobern sie einige Quadratkilometer dazu.
Gleichzeitig drängen die Russen in der Region Kursk die ukrainischen
Verbände zurück, die dort ein Gebiet erobert hatten. Die
Verhandlungsposition der Ukraine gegenüber Wladimir Putin wird damit
schleichend schlechter. Nun fallen ihnen auch noch die USA in den Rücken, indem sie andeuten, dass die Ukrainer die russisch besetzten Gebiete nicht
zurückbekommen werden.
Nicht nur das: Die neue Trump-Regierung verweigert bisher auch alle Sicherheitszusagen für die Ukraine, auch für den Fall, dass es zu einem Waffenstillstand kommen sollte. Das heißt: Wenn Putin und Trump die Ukraine nach ihren Vorstellungen aufgeteilt hätten, wäre die Restukraine der Gnade Putins ausgeliefert. Oder – und hier kommen die Europäer ins Spiel – es bräuchte Verbündete, die politisch willens und militärisch in der Lage wären, die Russen von weiteren Annexionen abzuhalten.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigte bereits an, dass
keine US-Soldaten in die Ukraine geschickt würden, um eine Feuerpause abzusichern.
Sollten britische, französische oder deutsche Soldaten diese Aufgabe übernehmen, müsste sie die USA noch nicht mal verteidigen. Selbst wenn die Russen die europäischen Soldaten angreifen sollten. Denn die Ukraine ist kein Nato-Gebiet, die Bündnisverpflichtungen würden für die USA dort nicht greifen.
Hegseth scheint die Verbündeten im alten Europa ganz allein in der Verantwortung zu sehen.
Die Botschaft lautet: Die Europäer sollen sich um die
Probleme in ihrer Nachbarschaft selbst kümmern. Der neue Verteidigungsminister will, dass die
USA sich sowohl militärisch als auch politisch auf China und
den Indopazifik fokussieren können.
Europa ist militärisch zu schwach
Die Europäer sind sich einerseits der neuen Verantwortung, die nun auf sie zukommt, bewusst. „Diese Lücke, die da entsteht, die müssen wir Europäer
schließen“, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius im ZDF. „Und
das wird man nicht schaffen mit zwei oder zweieinhalb Prozent
Verteidigungsausgaben.“
Das deutet schon das – gelinde gesagt – Unwohlsein an, mit dem Europäer auf die ihnen offenbar zugedachte Rolle blicken. Die neue Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, brachte es im NDR so auf
den Punkt: „Es kann nicht sein, dass
Russland die ukrainischen Gebiete bekommt, die USA die
Bodenschätze und Europa die Zeche zahlt für die
Friedenssicherung.“
Denn Kallas, Pistorius und andere europäische Politiker wissen, dass es nicht nur beim Geld schwierig würde. Den EU-Staaten und den Briten fehlen Soldaten, um Tausende
Männer und Frauen für eine Friedenstruppe abzustellen. So mancher europäische
Staat mit guten Beziehungen nach Moskau wird dazu ohnehin nicht bereit sein, Ungarn etwa oder die Slowakei. Und andere Länder wie Spanien oder Italien haben sich bislang vornehm zurückgehalten, wenn es um militärische Unterstützung der Ukrainer geht. Andere EU-Mitglieder sind kaum in der Lage, größere Truppenkontingente dauerhaft nach Osteuropa zu verlegen, zusätzlich zu den Verpflichtungen, die sie bereits in der Nato eingegangen sind.
Die Europäer könnten schlicht genug gut ausgestattete Soldaten für einen Einsatz in der Ukraine zusammenbekommen. Würde der heutige Frontverlauf zur Demarkationslinie in einem Waffenstillstand, würde sich diese von
Charkiw im Norden bis Saporischschja im Süden ziehen. Mehr als 1.300 Kilometer. Das würde Europas Streitkräfte überfordern. Auch die deutsche Bundeswehr.
Große Teile des deutschen Heeres sind
bereits für Nato-Verpflichtungen abgestellt, etwa in der Nato Response Force, die im Osten das Bündnisgebiet gegen Aggressionen Russlands
absichern sollen. Das Bundesverteidigungsministerium stellte im Vorjahr dazu fest: „Im Rahmen des Nato Force Models geht Deutschland mit der Bundeswehr de facto ‚all in‘.“ Woher sollten die Truppen für einen Ukraineeinsatz also kommen?
Die jahrelange Mission in Afghanistan hat zudem gezeigt, wie stark ein großer Auslandseinsatz die Bundeswehr bindet. Für einen Soldaten, der an den Hindukusch gesandt wurde, brauchte es gut zehn Männer und Frauen als Unterstützungskräfte. Selbst, wenn es dem Verteidigungsministerium endlich gelingen sollte, die Zahl der Uniformierten auf 203.000 zu erhöhen, wie seit vielen Jahren angestrebt, aber nie erreicht wurde – selbst dann fehlten noch abertausende Soldaten für eine anspruchsvolle Mission in der Ukraine. Wie auch immer diese konkret aussehen würde. Derzeit hat die Bundeswehr etwas mehr als 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Tendenz minimal schrumpfend.
Und während die Truppe nicht größer wird, werden es aber die Aufgaben und die Versprechen der Bundesregierung an die Nato. So übernimmt Deutschland in Litauen für die Verteidigung der
Allianz eine zentrale Aufgabe. Dort will die Bundeswehr eine dauerhaft
stationierte Brigade aufstellen, also 5.000 Soldaten. Aber das Projekt läuft durchaus zäh. Zwar
hat bereits ein Vorauskommando die Arbeit aufgenommen, aber gerade erst hat der
Bundestag einem Gesetz zugestimmt, das den Einsatz an der „Ostflanke“ finanziell extra belohnt, um endlich mehr Soldaten dafür zu gewinnen. Ein
Einsatz in der Ukraine wäre sicherlich kaum beliebter, weil ungleich gefährlicher, wie ein genauer Blick auf die Details der militärischen Lage zeigt.